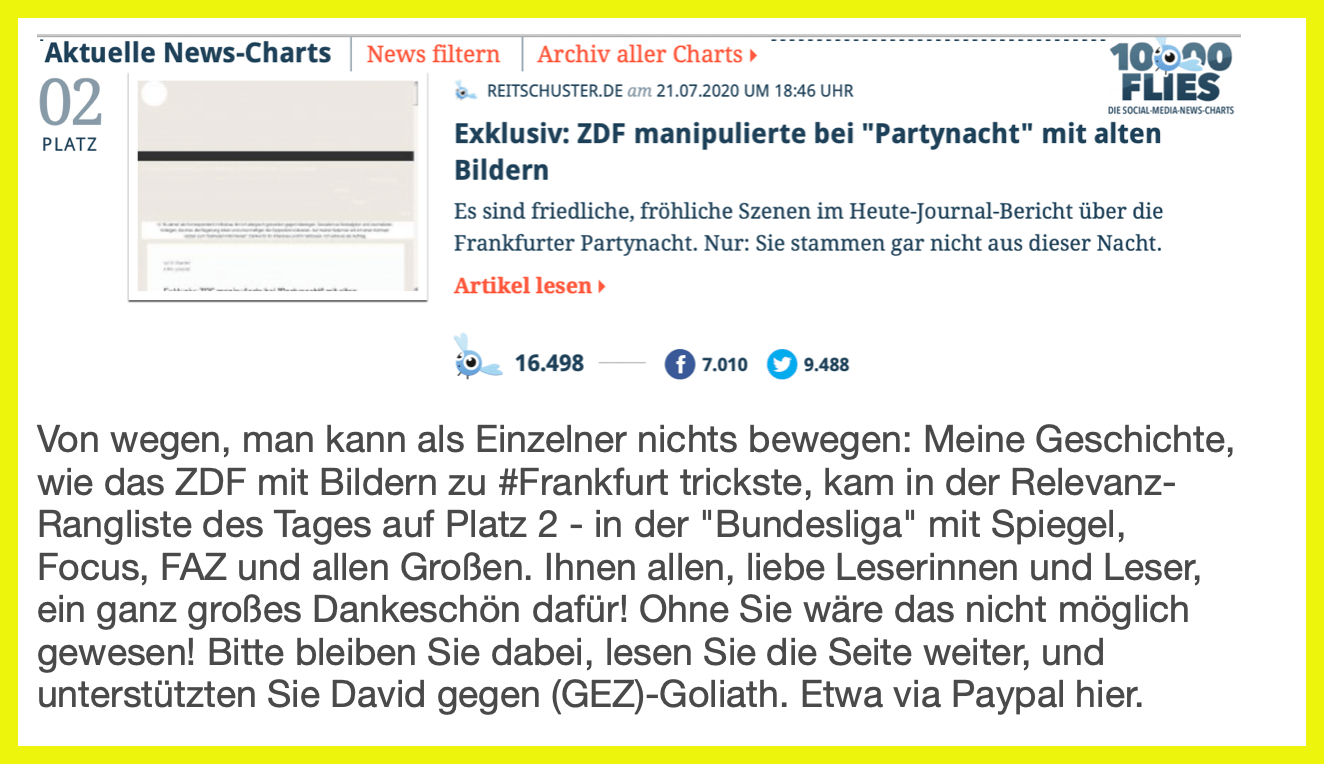Nach den Krawallen in Stuttgart und Frankfurt haben der Tübinger Grünen-Oberbürgermeister Boris Palmer und zwei seiner Kollegen in einem Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) einschneidende Schritte gefordert. Unter anderem will er ein Pflichtjahr für alle jungen Menschen und ein härteres Durchgreifen gegen Randalierer.
Bereits im Mai hatten Grünen-Mitglieder in einem offenen Brief den Ausschluss von Palmer aus der Partei gefordert.
Ich dokumentiere den Brief hier im Wortlaut:
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrter Herr Innenminister,
mit großer Sorge verfolgen wir Oberbürgermeister nicht erst seit der jüngsten Krawallnacht in Stuttgart oder jetzt am Wochenende in Frankfurt am Main die zunehmende Aggressivität und Respektlosigkeit von Gruppen mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen in unseren Städten. Vor allem die Begegnung mit Einsatzkräften der Polizei, den Rettungsdiensten und der Feuerwehr, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Verwaltungen in unseren Städten, aber auch die Auseinandersetzungen und Kontakte in unserem Alltag generell, sind hier geprägt von Provokation, mangelnder Kommunikationsfähigkeit, einem schwäbisch gesagt unverschämten „Rotzbuben-Gehabe“ und – in jüngster Zeit wachsend – auch von purer Gewaltbereitschaft. Wir sind hier mit Ihnen einer Meinung: Dies dürfen wir nicht länger hinnehmen!
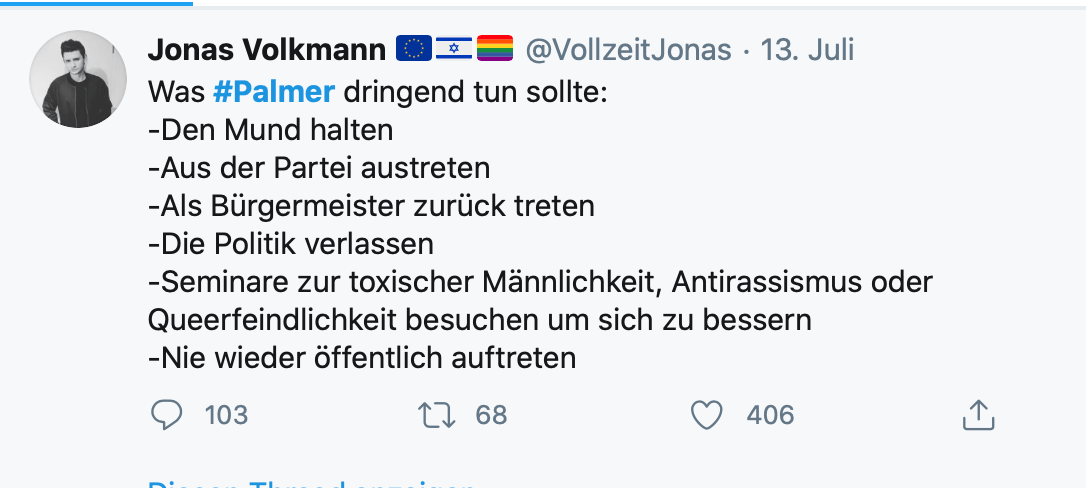
Wir Oberbürgermeister sind uns als Experten der Stadtgesellschaften vor Ort aber auch darüber im Klaren, dass wir in dieser Diskussion mit einer pauschalen, dumpfen Brandmarkung junger Menschen als fanatisierte, marodierende Ausländerhorden so wenig weiterkommen wie mit einer von der eigenen Moral berauschten sozialpädagogischen Betreuungsromantik. Das Ausblenden und Tabuisieren von kulturellen, sozialen, religiösen und familiären „Karrieren“ solcher städtischen Stressgruppen hilft uns genauso wenig, wie die von Ideologie getragene Fixierung auf Gruppenmerkmale und Vorurteile. Beides macht es sich zu einfach.
Aus unserer Sicht bedarf es dabei zweier Antworten:
Zum einen die des Rechtsstaats: Wir teilen Ihre Ansicht, dass wir hier konsequent mit den Mitteln der Polizei und der Justiz reagieren müssen! Unsere Gesetze, unsere hervorragend ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unsere Strukturen in
Baden-Württemberg bieten alle Möglichkeiten, angemessen, abgestuft, deutlich und mit Nachdruck gegen Gewalt, Vandalismus und Aggression vorzugehen und die Einhaltung von Regeln und Gesetzen durchzusetzen. Hier braucht der Staat, hier brauchen wir nicht neue Gesetze, sondern mehr Selbstbewusstsein, Mut und vor allem schnelles Handeln und eine schnelle Verurteilung nach begangene Straftaten. Von unserer Seite dazu ein klares Wort: Wir Oberbürgermeister stehen hinter unseren Polizistinnen und Polizisten im Südwesten!
Das allein ist aber nicht genug. Wir müssen auch ehrlich und offen nach den Ursachen der ähnlich gelagerten Gewaltausbrüche in Stuttgart und Frankfurt fragen. Es scheint plausibel, dass der Frust über die Freiheitsbeschränkungen in der Corona-Zeit dabei eine Rolle gespielt hat. Ebenso spricht manches für die These, die Debatte über Rassismus bei der Polizei nach dem schrecklichen Tod des US-Amerikaners George Floyd, habe zur Wut auch auf unsere Beamten beigetragen. Ein Aspekt findet jedoch in der Debatte bisher kaum Beachtung: Die Rolle von Geflüchteten bei der Entstehung einer gewaltbereiten Szene in der Stuttgarter Innenstadt.
Bisher ist bekannt, dass neun von 24 in der Nacht fest genommenen jungen Männer einen
„Flüchtlingsbezug“ haben, also als Asylbewerber ins Land gekommen sind. Viele Tatverdächtige sollen einschlägig bei der Polizei bekannt sein. Auf Videos und Fotos aus der Krawallnacht kann man erkennen, dass auch viele weitere Beteiligte an den Krawallen zu dieser Gruppe gehören könnten. In dieselbe Richtung deuten Aussagen der Polizei, wonach in den letzten Wochen bei Kontrollen in der Stuttgarter Innenstadt 70% der Probleme auf dort versammelte junge Männer mit Flüchtlingsbezug entfallen seien. Es ist keine Stammbaumforschung, sondern notwendige Präventionsarbeit, das präzise zu analysieren.
Wir halten das jedenfalls nicht für einen Zufall, sondern für die Fortsetzung eines Musters, dass bei vielen Straftaten der letzten Jahre erkennbar war: Unter den Geflüchteten gibt es eine kleine Gruppe gewaltbereiter junger Männer, die eine starke Dominanz im öffentlichen Raum ausüben und weit überdurchschnittlich an schweren Straftaten insbesondere der sexuellen Gewalt und Körperverletzung beteiligt sind. Die Polizeiliche Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts bestätigt, dass es sich dabei nicht um Einzelfälle handelt, sondern um ein strukturelles Problem mit etwa 50.000 Mehrfachstraftätern unter den Geflüchteten.
Unsere Erfahrung mit diesen jungen Männern sagt uns: Das ist kein Problem der Landeshauptstadt. In jeder Mittelstadt in Baden-Württemberg hat sich mittlerweile ein Milieu nicht integrierter, häufig mit Kleinkriminalität und Straftaten in Verbindung zu bringender junger geflüchteter Männer gebildet, das an Bahnhöfen und öffentlichen Plätzen zusammenkommt. Von diesen sind mittlerweile viele nicht mehr für Sozial- oder Integrationsangebote erreichbar. Dafür ist neben Traumatisierung und Gewalterfahrungen auch eine herkunftsgeprägte Männlichkeitskultur verantwortlich. In vielen Fällen paart sich diese mit Enttäuschungen und Frustrationen über die Realität ihres Lebens in Deutschland.
Sie fühlen sich nicht angenommen, sehen keine Perspektiven, oft wegen fehlender Aussicht auf Anerkennung völlig zurecht, haben keine Betätigung und können keine positiven Selbsterfahrungen machen. Eine gefährliche Mischung, die auch bei Ur-Gmündern,
Ur-Schorndorfern und Ur-Tübingern zur Gefahr für die Allgemeinheit werde müsste.
Wir haben Ihnen diese Problematik schon im Jahr 2017 vorgetragen und für einen doppelten Spurwechsel plädiert. Einerseits, so unsere Auffassung, müssen auch die Flüchtlinge ohne Aussicht auf Anerkennung eine Perspektive erhalten. Die Mehrheit ist nun mehr als
vier Jahre im Land, Abschiebungen sind nur noch bei wenigen zu erwarten. Statt Arbeitsverboten wären sinnvolle Betätigungsfelder für diese jungen Männer notwendig. In Gmünd haben wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht, junge Männer am Bahnhof als
„Kofferträger“ einen Sinn ihres Alltags zu geben. Auch die daraus entstehenden Kontakte waren wertvoll. Dieselbe Wirkung zeigte der Einsatz als Helfer bei der Landesgartenschau. Die Kommunen brauchen Instrumente und Möglichkeiten, um solche Tätigkeiten für die Allgemeinheit verpflichtend zu machen.
Dieser Weg wäre viel wirksamer als nicht eintreibbare Geldstrafen oder Freiheitsentzug nach kleineren Straftaten. Wer sich bewährt, eine Ausbildung absolviert oder eine Stelle findet, sollte einfacher als heute die Chance bekommen, ein Aufenthaltsrecht zu erwerben. Junge Männer brauchen Leistungsanreize statt Trübsal und Langeweile. Daher sollte ein Wechsel aus aussichtslosen Duldungsverfahren in ein Aufenthaltsrecht durch Leistung, Integration und Arbeit möglich sein. Es gibt gesetzliche Verbesserungen in diesem Punkt, aber für die Problemgruppe sind diese bisher kaum nutzbar. Die Hürden sind zu hoch.
Und bei manchen genügen Anreize einfach nicht. Davor die Augen zu verschließen, macht nichts besser. Für die jungen Männer auf Abwegen wäre es auch zu ihrem Schutz extrem wichtig, dass unser Staat ihnen frühzeitig für sie verständlich zeigt, wo Schluss ist. Das tun wir nicht. Im Gegenteil. Kleinkriminalität und stetige Konflikte mit der Polizei haben für Geflüchtete nur in seltenen Fällen reale Konsequenzen. Diese in vielen Herkunftsländern unbekannte Liberalität des Rechtsstaates wird oft als Schwäche unserer Polizei gedeutet und als Einladung zur Fortsetzung des strafbaren Verhaltens verstanden. Deshalb brauchen wir neben dem Wechsel zum Aufenthaltsrecht durch eigene Anstrengung auch einen Wechsel raus aus dem attraktiven Sozialraum der Städte und Gemeinden in Folge von dauerhaftem Fehlverhalten.
Wir wissen, dass für diese jungen Männer eine zeitweilige Rückverweisung in die Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes eine spürbare Sanktion wäre. Dort ist im Gegensatz zu den auf Integration ausgerichteten Unterbringungen in den Städten eine Kontrolle durch Polizei und Sicherheitskräfte möglich. Es wäre auch gegenüber friedlichen jungen Leuten besser erklärbar, gezielt die Tunichtgute mit Einschränkungen zur Raison zu bringen, als alle mit nächtlichen Ausgangssperren und Alkoholverbote in Haftung zu nehmen.
Das Land Hessen hat eine Regelung, die unserem Vorschlag ähnelt, in den Koalitionsvertrag aufgenommen, ohne dass dies auf rechtliche Bedenken gestoßen ist. Die Anstrengungen, Gefährder des Landes zu verweisen, begrüßen wir. Jedoch betrifft das nur eine extrem kleine Anzahl von Geflüchteten. Die Gruppe, um die es uns geht, fällt nicht unter die Gefährder, auch wenn manche von ihnen am Ende einer schiefen Bahn dort ankommen werden. Für die meisten gilt das aber nicht.
Natürlich wissen wir, dass diese unbequeme Wirklichkeit in unseren Städten politisch heikel ist. Wenn Sie unserem Vorschlag folgen, wird Ihnen daraus sofort ein Rassismus-Vorwurf konstruiert. Wir sind aber der Überzeugung, dass wir Rassismus bekämpfen können, wenn wir die Kriminalitätsrate unter jungen Geflüchteten Männern, insbesondere im Hinblick auf Straftaten im öffentlichen Raum, senken. Denn dies ist einer der Quellen für Ängste und Wut, aus denen Rassismus Energie bezieht.
Richtig ist zweifelsohne, dass die Mehrheit der Krawallbrüder in Stuttgart keine Geflüchteten waren. Auch über die mangelnde Integration dieser jungen Männer in unsere Gesellschaft müssen wir uns Gedanken machen. Wir glauben, dass die Wiedereinführung eines verpflichtenden Dienstes an der Gesellschaft dafür richtig wäre.
Respekt, Akzeptanz, Toleranz, den verantwortungsvollen Umgang mit Menschen lernt der junge Mensch nicht bei Wikipedia, Facebook und Instagram, sondern in der Begegnung mit anderen. In der Familie. In der Schule. Am Ausbildungsplatz. Im Verein. Im Alltag. Hier übt man den Diskurs und den Umgang miteinander. Ja: manchmal auch steinig, hart und schmerzhaft. Diese sozialen Trainingsräume werden allerdings immer weniger.
Deshalb fordern wir, dass in Deutschland dringend ein verpflichtender gesellschaftlicher Grunddienst für alle jungen Menschen eingeführt wird, die in unserem Land leben – unabhängig von der jeweiligen Staatsbürgerschaft. Zwölf Monate sollen sich die jungen Menschen hier für die Gesellschaft engagieren. Dieses soziale Pflichtjahr soll in der Tat für alle gelten – sei es bei der Bundeswehr (die Aussetzung des Wehrdienstes sollte ohnehin jetzt beendet werden), sei es in sozialen oder kulturellen Einrichtungen, bei der Betreuung von älteren Bürgerinnen und Bürgern, sei es bei Arbeiten für die Städte und Kommunen. Für alle Dienstleistenden, die sich nicht auf Bundesebene, zum Beispiel im Wehrdienst oder beim THW engagieren, ist dabei die eigene Stadt, die eigene Gemeinde der richtige Ort für ein passendes Pflichtjahr. Hier sieht man sofort und konkret, was man mit seinem Einsatz bewegen kann. Und sie ist der passende Trainingsraum für das Einüben der sozialen Fertigkeiten, die unsere Gesellschaft als unabdingbare Grundlage benötigt.
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrter Herr Innenminister,
wir bitten Sie daher um die Unterstützung bei der Einführung eines Pflichtjahres für einen gesellschaftlichen Grunddienst in Deutschland, indem Sie:
1. über den Bundesrat und die Kontakte zum Bund sowohl auf Regierungsebene wie auch in den jeweiligen Parteien eine solche Dienstpflicht für alle Menschen in unseren Städten und Gemeinden anregen,
2. die rechtlichen, finanziellen und strukturellen Möglichkeiten, Chancen und Zielrichtungen einer solchen Dienstpflicht für alle in Baden-Württemberg aufzeigen und
3. Gespräche zu einer solchen Umsetzung mit den Vertreterinnen und Vertretern des Städte-, Gemeinde- und Landkreistages initiieren und aufnehmen.
4. Den doppelten Spurwechsel in Baden-Württemberg als Anreiz- und Sanktionssystem zu etablieren.
Wir – als drei Oberbürgermeister ganz unterschiedlich strukturierter Städte und ganz unterschiedlichen politischen Hintergrundes – bieten Ihnen vollumfängliches Engagement und Mitarbeit an. Wir denken, dass wir auf die oben genannten großen Herausforderungen auch mit einem nicht minder großen, mutigen, starken Schritt reagieren müssen. Die Juristinnen und Juristen werden viele Vorbehalte und Einwände haben. Das wissen wir. Aber hier bedarf es einer politischen Antwort. Und wenn nötig muss die Politik auch das Rechtliche neu ordnen.
In diesem Sinne, mit besten Grüßen aus Schwäbisch Gmünd, aus Tübingen und aus Schorndorf,
Richard Arnold, Oberbürgermeister der Stadt Schwäbisch Gmünd
Boris Palmer, Oberbürgermeister der Universitätsstadt Tübingen
Matthias Klopfer, Oberbürgermeister der Stadt Schorndorf
Bilder: Reinhard Kraasch/Wikicommons/CC BY-SA 3.0