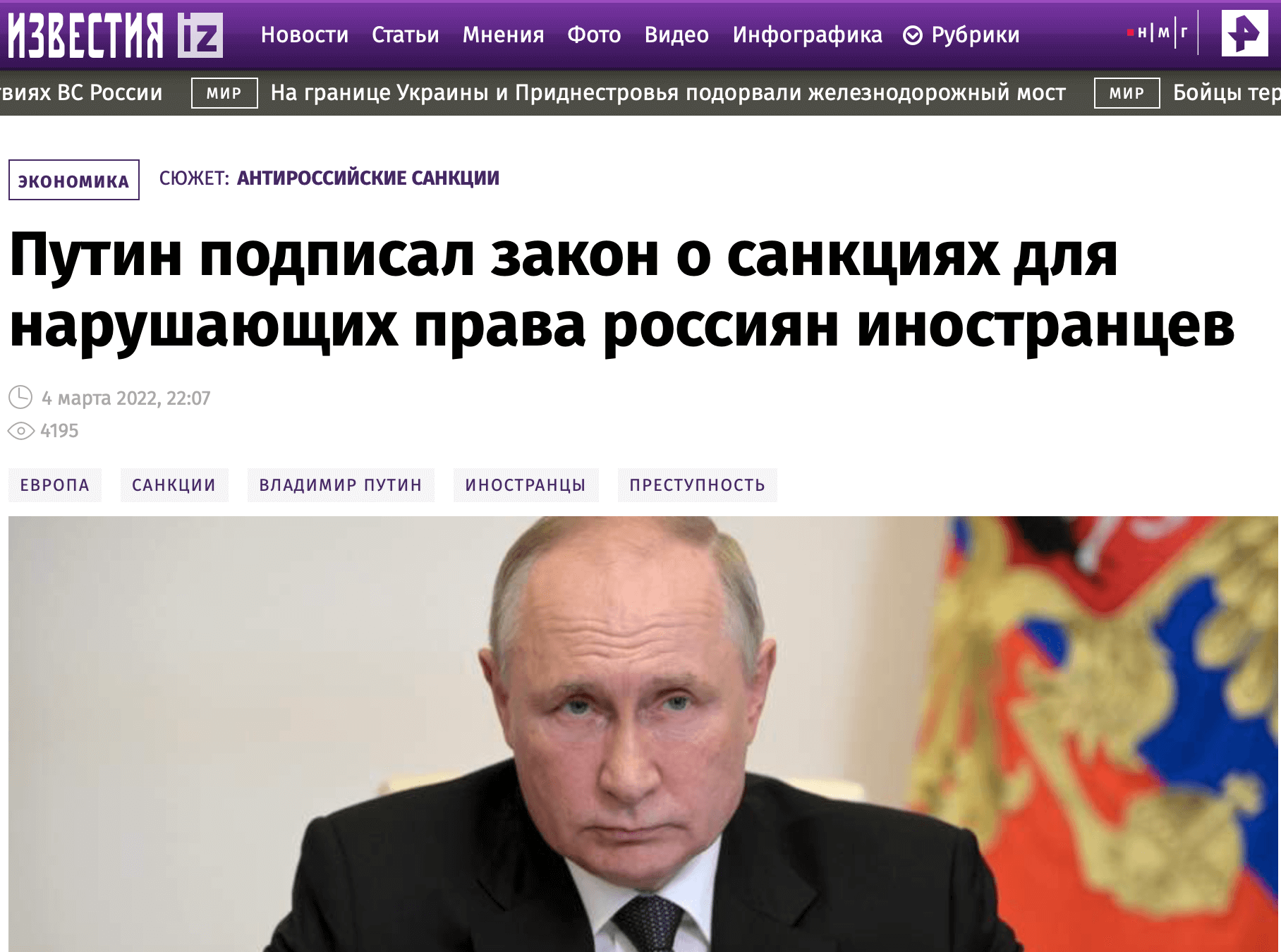Ein Gastbeitrag von Stefan Jahnel
Es ist mein zweiter Besuch der Ukraine. Es geht darum, Medikamente in das Land zu bringen. Ein ukrainischer Fahrer ist in Frankfurt gestartet, aber er kann nur bis zur Grenze fahren. Als wehrfähiger Mann dürfte er nicht wieder zurück. Er fährt lieber Transporter als an die Front. Einige seiner Kollegen haben sich anders entschieden.
Tag 1
Es ist schwierig, Dinge in die Ukraine zu transportieren. Die wenigsten Polen haben Lust. Aber einer muss den Scheiß ja machen. Also sitze ich seit Kattowitz am Steuer. Der Ukrainer hat den Zug zurück nach Frankfurt genommen. Auf dem Beifahrersitz Steven Tereshchenko-Schuster. Er war in Deutschland Sanitäter und hat sich dann bei der ukrainischen Armee gemeldet. Mittlerweile organisiert er über Medicines For Ukraine Spenden für die Ukraine. Unser erstes größeres Ziel ist Ternopil. An der Grenze geht es schnell. Humanitär, medizinische Transporter werden vorbeigewunken. Normale LKW-Fahrer dürfen mitunter schon mal einen Tag warten.
Kurz nach Ausbruch des Krieges standen alle 30 Kilometer Checkpoints, oft ein Dutzend alter Rentner und JuEs ist schwierig, Dinge in die Ukraine zu transportieren. Die wenigsten Polen haben Lust. Aber einer muss den Scheiß ja machen. gendliche, die stolz mit ihrer Kalaschnikow patrouillierten und Ausweise genau in Augenschein nahmen. Die Zahl der Checkpoints hat sich merklich verringert. Oft sind es nur drei oder vier Milizionäre, die gelangweilt bei Nieselregen in einem Unterstand kauern. Die Straßen sind ein Abenteuer geblieben. Schlagloch an Schlagloch. Besser tagsüber zu befahren. Ab 23 Uhr ist sowieso Ausgangssperre.
Erste Brownout-Erfahrungen in Lviv (Lemberg). Steven ist das schon gewohnt. Abwechselnd werden verschiedene Stadtteile vom Strom abgeklemmt. Gute Hotels haben Stromgeneratoren. Wir haben ein einfaches Hotel. Um 22 Uhr ist der Strom weg. Kein Licht. Der Laptop hat Akku, aber das Internet ist auch weg. Eingeschränktes Arbeiten. Kein Licht, wenn man mitten in der Nacht aufs Klo muss. Glücklicherweise hat das Handy eine Taschenlampe. Nur, wo ist das Handy? Wichtige Regel: Handy immer auf den Nachttisch legen. Brownouts erziehen zur Ordnung.
Tag 2 – Ternopil
Ein Teil der Medikamente wird bei der medizinischen Fakultät der dortigen Uni abgegeben. Professorin der Pharmakologie Oleksandra Oleshchuk erwartet uns. Mit ihr reden wir über die medizinische Situation. Es fehlt an allem, an fast allem. Woran es nicht gefehlt hat, waren Corona-Masken. Nur haben die Leute hier halt andere Probleme. Ständige Stromabschaltungen haben zu einer regelrechten Erkältungswelle geführt. Die pharmazeutischen Produktionsstätten in der Ukraine werden bevorzugt mit Strom versorgt. Stromausfälle ganz ausschließen geht aber nicht. In der Pharmazie ist das jedes Mal eine Katastrophe. Was „normale“ Erkrankungen anbelangt, lässt sich vieles noch organisieren. Wer bei einer Krebsbehandlung aber auf die Einhaltung eines exakten Therapieplanes angewiesen ist und spezielle Medikamente benötigt, hat das Nachsehen. Ironischerweise ist es relativ einfach, verwundete Soldaten im Ausland behandeln zu lassen. Für Krebspatienten ist niemand zuständig.
Am Abend Koordinierung mit einem Musikmanager von „Musiker defend Ukrain“. Eine seiner Bands tourt gerade durch Europa, um Spendengelder zu akquirieren. Kultur gibt es dann auch im Theater. Ein modernes Stück. Nicht modern wie im Westen. Abstrakt, aber schön, abstrakt, futuristisch, eine ästhetische Formensprache. Keine Ahnung, worum es geht, aber man ist einfach mitgerissen.
Tag 3 – weiter nach Kiew
Zeit, sich mit Steven zu unterhalten. Er war bis vor kurzem Frontsanitäter. Die Ukrainer haben eine eigene Einheit bewaffneter Frontsanitäter zusammengestellt. Unabhängig vom Roten Kreuz. Die Frontsanitäter tragen kein Rot-Kreuz-Abzeichen. Sie sind eine bewaffnete Einheit. Die schießen zurück, wenn sie unter Feuer geraten. Pardon wird nicht verlangt, Pardon wird nicht gegeben. Wie hält man das eigentlich aus? Er war früher Rettungssanitäter in Deutschland. Eine 5-Jährige, die von einer Rakete getroffen wurde, sieht auch nicht anderes aus als eine 5-Jährige, die bei einem Unfall über drei Streifen der A8 verteilt wurde. Ich habe der Logik nichts entgegenzusetzen. Aber Scheiße, wie abgefuckt wurden wir? Alles Scheiße. Aber es tut gut, dass sie zum Schluss Leute brauchen wie uns, die die Scheiße einfach machen, weil einer die Scheiße einfach machen muss. Aber vielleicht würde es ja die ganze Scheiße nicht geben, wenn es keine Leute gäbe, die die Scheiße machen, die getan werden muss. Egal. Wir stehen jedenfalls auf der richtigen Seite. Wir stehen immer auf der richtigen Seite.

Es geht nicht direkt nach Kiew, sondern in eine Ortschaft kurz außerhalb. Die letzten zwei Stunden Buckelpiste. Empfohlene Richtgeschwindigkeit 40 Stundenkilometer. Das gilt aber nur in Friedenszeiten. Vorausschauendes Fahren erlaubt auch das Doppelte, im Zickzack um die größten Krater herum. Frost, keine Einschläge. So viel Missiles hätte Putin gar nicht gehabt. Das Hauptquartier ist eine Datscha. Die letzten Kilometer sind ein Feldweg, ein Schlammloch. Ich kann jeden Moment „steckenbleiben“. Kein Problem. Ist dem Besitzer von der Datscha auch schon mal passiert. Er wurde dann mit einem Traktor wieder rausgezogen. Eigentlich war da schon klar, dass der Traktor kommen würde. Es gibt immer den Moment, an dem man weiß, dass man hätte umdrehen müssen. Nur kann man dann nicht mehr umdrehen. Dann muss man durch. Der Punkt, an dem man hätte umdrehen müssen, liegt immer in der Vergangenheit.
100 Meter weiter war es dann so weit. Eine leichte Anhöhe und links einen Abhang hinunter. Kein großer Abhang. Vielleicht gerade tief genug, dass sich der Sprinter ein- oder zweimal überschlägt. Also keine Panik. Nur nicht ins Rutschen kommen. Wir kommen nicht ins Rutschen. Wir bleiben nur stecken.
Mein Navigator steigt aus und erkundet die Lage. „Oh, das ist doch nicht der Weg zu unserer Datscha“. Aber 100 Meter weiter ist ein Haus. Hilfe holen. Der Traktor soll in einer halben Stunde da sein. Nach einer Stunde ist ein weiterer PKW da. Erste Abschleppversuche. Der Sprinter bewegt sich keinen Zentimeter. Die Hinterreifen graben sich richtig tief ein. Und da ist immer noch dieser verdammte Abgrund. Der PKW-Fahrer gibt auf. Erstmal auf der Datscha übernachten. Morgen wird alles besser. Google Maps ist schuld. Egal. Trotzdem schuldet mir der Herr Navigator für den nächsten Abend Bier, Schnaps und ein paar Djewotschkas (junge Mädchen).
Tag 4 – immer noch kein Traktor da
Dafür aber ein Fahrer eines geländegängigen Fahrzeuges. Der winkt aber ab. Weiser Mann. In dem Haus am Ende des Feldweges wohnt eine Babuschka (alte Frau/Großmutter). Sie lädt mich zum Kaffee ein. Irgendwie hätte ich das mit Bier, Schnaps und Djewotschkas wohl klarer formulieren müssen. Wir stehen im Vorraum ihres Hauses, eigentlich eher eine Hütte, so was, was man sich als Mönchsklause vorstellt. Es ist verdammt kalt. Der Wasserkocher läuft. Ein uraltes Ding. Es dauert gefühlt Stunden, bis der Kaffee kocht.
Das Thermometer ist gefühlt im zweistelligen Bereich – minus. Nein, es ist wärmer, sonst wäre die Straße nicht so eine verdammte Schlammwüste, sondern schön ordentlich festgefroren. Trotzdem, es ist verdammt, verdammt kalt. Die Babuschka wäscht Winteräpfel im kalten Wasser mit der blanken Hand. Der Kaffee wärmt mich für gerade eine Viertelstunde. Der Westen ist total degeneriert.
Zwei Stunden später ist der Traktor da. Die ersten hundert Meter gehen gut. Versuche, den Sprinter beim Anschleppen zu starten, schlagen fehl. Nicht schlimm. Die letzte Steigung schafft auch der Traktor nicht. Das heißt, er schafft sie schon. Aber ohne Sprinter. Plan: warten auf Frost. Wenn der Boden gefroren ist, sollte es gehen. Inzwischen wird ein Teil der Ladung auf einen PKW verladen. Jedes Stück einzeln, 300 Meter zu Fuß. Stromaggregate sind schwer, verdammt schwer. In mir reift eine Verschwörungstheorie: „Die Konspiration der Dorfbewohner.“ In spätestens einer Woche sind wir weg, dann wird der Sprinter auseinandergebaut und auf dem Markt gegen Wodka eingetauscht … Die Medikamente und ein Stromgenerator müssen dringend in einer Kiewer Kinderklinik. Und Pampers. Ich fahre Windeln nach Kiew. Wir schaffen eine Fuhre. Man sollte aber durchaus auch zwei oder drei schaffen. Trotzdem: Der Sprinter muss ja auch irgendwie nach Deutschland zurück. Möglichst bevor der Krieg zu Ende ist. Am Abend total fertig. Kein Bier, kein Schnaps, keine Djewotschka. Nur schlafen.

Tag 5 – Frost
Ein neuer Traktor ist da. Und sie ziehen den Sprinter endlich über den Hügel. Aber anspringen will das verdammte Ding nicht. Erst mit einer neuen Batterie rattert der Motor wieder los. Auf dem Weg geht es durch das Nachbardorf Byschiw, das die Russen eingenommen hatten. In einer Kirche wurden mehrere Zivilisten erschossen. Die Spuren der Verwüstung sind überall zu sehen. Stolz sind die Ukrainer aber auf das, was schon wieder aufgebaut wurde.
Tag 6 – auf der Datscha
Eigentlich sollte es ein Einblick in das ländliche Leben geben. Letztlich eher ein vergammelter Tag. Das einzig Wirkliche, was es zu tun gibt, ist Tee kochen und sich um den Müll kümmern. Die Müllabfuhr kommt nicht bis hierher. Die Müllverbrennungsanlage steht in Form einer großen Blechtonne im Garten. Den Einheimischen beim Eisfischen zuschauen. Ich will noch einen Blick auf die Landwirtschaft werfen. Geplant ist ein Besuch auf der Nachbar-Datscha. Die Zeit verstreicht. Bei Sonnenuntergang sind die besten Bilder zu machen. Als wir ankommen, ist von der Sonne nichts zu sehen, stattdessen steht die Milchstraße hoch am Himmel. Ein atemberaubendes Sternenpanaroma. Keine Lichtverschmutzung. Der Strom ist gerade mal wieder abgestellt. Nur ein paar einzeln erleuchtete Fenster geben an, wer sich einen Stromgenerator hat leisten können.
Einladung zum Essen. Wintergrillen. Kartoschkas, Salate und Wodka. Selbstgebrannter Wodka. In meiner Jugend war ich stolz, dass ich mit Polen und Russen um die Wette trinken konnte. Zum Trinken gibt es außer Wodka auch Kirschkompott. Nach der dritten Runde kippe ich immer nur noch das halbe Glas. Ich bin ja auch nur ein degenerierter Deutscher, der nicht ordentlich trinken kann. Ein Handyanruf. Jemand ist gestorben. Kein Fronttoter, sondern einfach ein Herzinfarkt. Trotzdem wird auf den Toten getrunken. Hier nur ein halbes Glas runterkippen? Undenkbar!!! Es geht weiter. Irgendwann ist der Kanister leer und wir dürfen nach Hause. Endlich schlafen.
Tag 7 – nochmal nach Kiew
Zwei Stromgeneratoren ausliefern. Steve bleibt länger in der Ukraine. Ich bekomme einen neuen Beifahrer. Einen Ukrainer. Zum Abschluss geht es in die Sauna. Wichtig: Es ist für die Gesundheit. Kein Wodka also. Nach jedem Saunagang gibt es lediglich Bier. Vorher aber nochmal ins eiskalte Wasser. Auf dem Teich treiben ein paar Eisschollen. Ich belasse es dabei, mich mit Schnee einzuseifen. Das muss reichen. Mitleidvolle Blicke. Egal. Zu dem Bier gibt es salzigen, geräucherten Fisch. Ist wichtig für den Körper. Macht auch irgendwie Sinn.
Tag 8 – zurück nach Ternopil: Julia und Roman
Nachmals an die Universität. Ein Raum der Fakultät ist voll mit Pappe, Paraffin und leeren Konservendosen. Nein, hier wird keine Mülltrennung vollzogen. Unter Anleitung von Dr. Olena Pokryshko basteln Studenten für die Front. Fein säuberlich wird die Pappe in die Konserve gestopft. Trotzdem, das Studium geht weiter. Zeitweise gab es nur Onlinevorlesungen, soweit dies möglich war. Wenn man Pech hat, ist auf einmal der Strom weg. Egal ob man gerade für die nächste Prüfung büffelt oder mit dem Fahrstuhl fährt – Treppensteigen ist en vogue. Online-Lehrinhalte am besten herunterladen. Bücher und Skripte erleben eine Renaissance.
Um 23 Uhr darf niemand mehr auf die Straße. Da heißt es dann zu Hause bleiben. Oder mit den Freunden, bis der Morgen graut, durchlernen. Meistens sind wir brav, lächelt Julia. Ob brav bedeutet, zu Hause zu sein oder bis zum Morgengrauen durcharbeiten, wird dabei nicht so ganz klar. Wenn sie lächelt, erreicht ihr Schmollmund die doppelte Breite.
In die mit Kartonage vollgestopften Konservendosen wird erhitztes flüssiges Paraffin geschüttet. Zwei Pappstreifen dienen als Docht. Wenn man die Dose jetzt anzündet, gibt sie nicht nur Licht, sondern über Stunden auch Wärme. Wichtig für einen Winterkrieg.
Unter den Helfern befinden sich auch ihr Freund Roman, eine Dozentin mit ihrem Sprössling und ein indischer Student. Die meisten Studenten haben zunächst die Ukraine verlassen. Viele Ukrainer sind zurückgekehrt, die meisten ausländischen Studenten nicht. Manche sind online noch mit dabei. Aber das ist nicht dasselbe. Schließlich geht es nicht nur um das Studium. Man hat viel voneinander gelernt. Sprache, Kultur etc. Das Studium geht weiter, das Leben geht weiter. Julia und Roman studieren Medizin. Mit der Theorie ist es jetzt manchmal schwierig. An Lernen in der Praxis ist kein Mangel. Auch das bringt der Krieg mit sich.
Tag 9 – Lemberg
Weiter Richtung Heimat. Richtiger Wintereinbruch. Die Straßen sind verschneit und glatt. Schneckentempo. Mittag sind wir in Lemberg. Lemberg lebt. Während des Essens in einem Café gibt es Luftalarm. Ab in den Keller. Dort wird weiter serviert, was fertig geworden ist. Kartoffeln und Salat sind fertig. Eier und Fleisch nicht. Egal. Preisnachlass. Nachts ist mal das eine Stadtviertel erleuchtet, dann das andere. Die meisten Cafés und Restaurants haben Stromgeneratoren. Um Energie zu sparen, ist nur ein Teil der Straßenlampen an. Die Parkautomaten sind abgestellt.
Bhagwan-Anhänger tanzen auf der Straße: Hare Krishna. In einer Bar wird Karaoke gesungen. Im nächsten Restaurant gibt es Zigeunermusik zu Speis und Trank. Schnell noch so viel und so intensiv leben, wie es geht. Man weiß ja nicht, was morgen kommt. In der Disco treffe ich Helena. Sie tanzt und dann liegt sie mit ihrem Kopf auf meiner Brust. Ihre Augen sind immer ein klein wenig traurig. Auch, wenn sie lustige Geschichten erzählt. Sie kommt aus der Ostukraine und wollte eigentlich nach Polen. Aber dann wollte sie doch nicht über die Grenze. Ich biete ihr an, mit mir mitzufahren. Aber egal. Dann will sie aber doch nach Kiew. Irgendwie hat sie da Verwandte.
Tag 10
Das Bescheuertste an der Stromsperre ist, dass auch die Dusche kalt bleibt. Helenas Körpergeruch bleibt doch länger an mir haften. Es ist eigentlich ganz angenehm. Wir wollen in Kontakt bleiben. Ihre Telefonnummer ist nicht vergeben. Erst mal weiter Richtung Heimat.
Für meine Arbeit müssen Sie keine Zwangsgebühren zahlen, und auch nicht mit Ihren Steuergeldern aufkommen, etwa über Regierungs-Reklameanzeigen. Hinter meiner Seite steht auch kein spendabler Milliardär. Mein einziger „Arbeitgeber“ sind Sie, meine lieben Leserinnen und Leser. Dadurch bin ich nur Ihnen verantwortlich! Und bin Ihnen außerordentlich dankbar für Ihre Unterstützung! Nur sie macht meine Arbeit möglich!
Aktuell ist (wieder) eine Unterstützung via Kreditkarte, Apple Pay etc. möglich – trotz der Paypal-Sperre: über diesen Link. Alternativ via Banküberweisung, IBAN: DE30 6805 1207 0000 3701 71. Diejenigen, die selbst wenig haben, bitte ich ausdrücklich darum, das Wenige zu behalten. Umso mehr freut mich Unterstützung von allen, denen sie nicht weh tut.
Gastbeiträge geben immer die Meinung des Autors wieder, nicht meine. Und ich bin der Ansicht, dass gerade Beiträge von streitbaren Autoren für die Diskussion und die Demokratie besonders wertvoll sind. Ich schätze meine Leser als erwachsene Menschen und will ihnen unterschiedliche Blickwinkel bieten, damit sie sich selbst eine Meinung bilden können.
Stefan Jahnel (geboren am 25. Januar 1969) war jahrelang nach dem Studium der Informatik als Lokaljournalist beim Freisinger Tagblatt tätig und gelegentlich für den Münchner Merkur. Seit über 10 Jahren betreibt er ein lokales Info-Portal www.moosburg.tv.
Als sich 1989 der eiserne Vorhang hob, nutze er die Gelegenheit, diesen in ihm bis dato unbekannten Teil unseres Kontinents zu erkunden. Seitdem hat er einige Kontakte ins Baltikum, nach Polen und in die Ukraine. Mithilfe eines nach Polen ausgewanderten deutsc
Ständige Stromabschaltungen haben zu einer regelrechten Erkältungswelle geführt. Die pharmazeutischen Produktionsstätten in der Ukraine werden bevorzugt mit Strom versorgt. Stromausfälle ganz ausschließen geht aber nicht. Jedes Mal eine Katastrophe. Es fehlt an allem, an fast allem. Woran es nicht gefehlt hat, waren Corona-Masken. Nur haben die Leute hier halt andere Probleme.
Ständige Stromabschaltungen haben zu einer regelrechten Erkältungswelle geführt. Die pharmazeutischen Produktionsstätten in der Ukraine werden bevorzugt mit Strom versorgt. Stromausfälle ganz ausschließen geht aber nicht. Jedes Mal eine Katastrophe. Es fehlt an allem, an fast allem. Woran es nicht gefehlt hat, waren Corona-Masken. Nur haben die Leute hier halt andere Probleme.
hen Fuhrunternehmers, dessen meisten Arbeitnehmer aus der Ukraine stammen, nutzte er die Gelegenheit, einen Hilfstransport nach Lemberg zu begleiten und dann zu einem Bekannten nach Kiew weiterzureisen.
Bild: Stefan Jahnelmehr zum Thema auf reitschuster.de