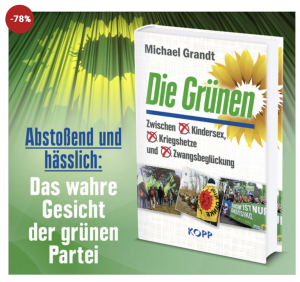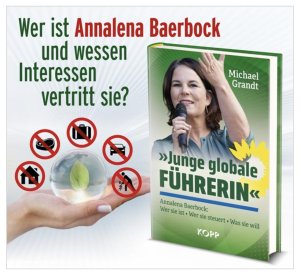Ein Gastbeitrag von Uta Böttcher
Immer wieder liest man, dass Küstenstädte und gar ganze Inseln schon in naher Zukunft im Meer versinken werden. Grund: der menschengemachte Klimawandel.
Doch ist das auch richtig? Eine wichtige Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist: Relativ zu welchem Bezugspunkt wird der Meeresspiegel denn gemessen? Ist ein Anstieg nur lokal begrenzt, läuten bei Geowissenschaftlern die Alarmglocken. Denn dann liegt eine lokale Ursache nahe – meist begründet in der Dynamik unseres Planeten und wohl kaum im menschengemachten Klimawandel.
Außenministerin auf Fidschi
So verhält es sich auch bei den Inseln des Südpazifik, wie den Fidschi-Inseln, die unsere Außenministerin kürzlich besuchte, um dort mit traurigem Gesicht durch den Sand zu waten. Weil in dieser Region der Meeresspiegel besonders schnell ansteige, müsse man die Menschen dort vor dem Untergang retten, lautete ihre Botschaft.
Dabei sind die Bewohner Ozeaniens mit Erdbeben und Überflutungen vertraut. Bei den Fidschis und den umliegenden ozeanischen Inselgruppen haben wir es mit Vulkaninseln zu tun. Es ist einer der tektonisch aktivsten Bereiche der Erde. Starke Erdbeben erschüttern die Region und Tsunamis überfluten den Strand. Die Bewohner der Südseeinseln haben es mit jährlichen Meeresspiegelschwankungen um 20 Zentimeter zu tun – verursacht von den Strömungen im Pazifik. Dieser Ort ist also denkbar ungeeignet, um einen globalen Meeresspiegelanstieg zu untersuchen.
Belastbare, naturwissenschaftlich fundierte Daten zu erarbeiten ist viel mühsamer, als mit einer Entourage von Hofberichterstattern Fotos mit im Korallensand versinkenden Außenministerinnenfüßen zu machen und diese zu verbreiten. Leider.
Denn: Unser Planet ist ein äußerst komplexes System, bei dem alle Komponenten in ständiger Bewegung sind. Die Erdkruste bewegt sich vertikal und horizontal, die Landmassen werden in geologischen Zeiträumen über den Globus hinweg bewegt, Wasserströmungen und Luftströmungen verändern sich ununterbrochen, Gletschereis schmilzt und entsteht neu.
Das Innere unseres Planeten ist heiß. Feste Lithosphärenplatten driften auf zähflüssiger Gesteinsmasse des Erdmantels. Diese zirkuliert wie das Wasser in einem Kochtopf und treibt die darauf treibenden Platten gemächlich und unaufhaltsam aufeinander zu, voneinander weg oder aneinander vorbei. Rund um die Ränder der driftenden Platten sind Erdbeben und Vulkane platziert. So auch hier.
Ungeeigneter Ort, um nach Beweisen für den Klimawandel zu suchen
Für die Bewohner der Inseln Ozeaniens gehören Erdbeben und Überflutungen daher zum Alltag. Die geotektonischen Verhältnisse könnten kaum komplizierter sein. Während die australische und die pazifische Platte aufeinander zu driften, taucht die pazifische Platte an der Tonga-Kermadec-Subduktionszone nach Westen ab, in direkter Nachbarschaft verschwindet die australische Platte Richtung Osten an der Salomon-Neue-Hebriden-Subduktionszone unter der Pazifischen. An den Plattenrändern entstehen Tiefseegräben wie der Kermadec-Tonga-Graben, fast 11.000 Meter tief. Und zwischen diesen Subduktionen bekommt die Erdkruste Risse und sinkt beckenförmig ein, zum Beispiel rund um die Fidschi-Inseln.
Die abtauchende Pazifische Platte ist von der schnellen Sorte: Mit mehr als acht Zentimetern im Jahr ist ihre Subduktionsgeschwindigkeit eine der höchsten unseres Planeten. Dadurch schafft sie es weit in den zähflüssigen Erdmantel hinein, bevor sie schließlich in diesem aufgeht. Die Erdbeben geschehen in bis zu 600 Kilometer Tiefe. Schließlich schmilzt das Oberflächengestein auf, geht sozusagen in den Erdmantel über.
Wie Kohlendioxidbläschen in einem Mineralwasserglas steigt diese Gesteinsschmelze wieder nach oben, denn sie ist leichter als das umliegende Mantelgestein, und es entstehen Vulkaninseln wie die Fidschis.
Starke Erdbeben sind die Konsequenz dieser tektonischen Verhältnisse – die Gesteinsplatten bleiben aneinander hängen, und die Spannung entlädt sich von Zeit zu Zeit – und diese wiederum verursachen Tsunamis.
Genau wegen dieser geologischen Besonderheit sind die Inseln im Südpazifik ein denkbar ungeeigneter Ort, um nach Beweisen für den Klimawandel zu suchen.
Glücklicherweise gibt es Forscherteams, die es sich zum Ziel gesetzt haben, den Anstieg des Meeresspiegels von der Absenkung der Erdkruste zu unterscheiden. Dies bedeutet jahrelanges geduldiges Sammeln von Daten. Zuerst müssen auf den Südseeinseln geeignete Plätze gefunden werden, wo die Messpunkte über Jahre hinweg zuverlässig funktionieren. Dorthin reisen die Wissenschaftsteams in regelmäßigen Abständen, um die Veränderungen zu messen. Was dabei herauskommt, sind richtige Messdaten – nicht zu vergleichen mit den Ergebnissen von Computersimulationen, wie es zum Beispiel die langfristigen Klimaprognosen sind.
Auf den Torres Inseln (Nord-Vanuatu, Südwest-Pazifik) ergaben Untersuchungen eines französischen Forscherteams, dass die Inseln in den Jahren von 1997 bis 2009 um 11,7 Zentimeter abgesunken sind.
In einer anderen, großräumiger angelegten Studie wurde der Einfluss vertikaler Landbewegungen auf den südwestlichen Inseln des tropischen Pazifiks untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die Absenkung der Erdkruste bei bis zu 4,2 Zentimetern pro Dekade liegt. Für Tahiti wird bis zum Ende des Jahrhunderts eine Absenkung von 80 Zentimetern prognostiziert.
Forschung ist darauf angewiesen, dass Gelder zur Verfügung stehen
Die Südseeinsel Vanikoro, ebenfalls zu Vanuatu gehörend, sinkt jedes Jahr um sieben Millimeter (siehe hier).
Auch das kurzzeitige Versinken einer Kokosplantage auf der Insel Tegua hatte tektonische Ursachen. Im Jahr 2005 hatten die Vereinten Nationen dort öffentlichkeitswirksam die ersten Klimaflüchtlinge der Welt ausgerufen. Eine Kokosplantage war im Meer versunken, und ein Dorf wurde umgesiedelt. Als sich bei einem großen Erdbeben im Jahr 2009 die Spannung im Untergrund wieder löste – dafür sind Erdbeben schließlich da – stieg die Kokosplantage wieder auf und war im Trockenen. (siehe hier).
Forschung ist darauf angewiesen, dass Gelder zur Verfügung stehen. Wenn die Themen der Forschungsprojekte, die ausgeschrieben werden, sich nur noch um den durch Menschen gemachten klimabedingten Meeresspiegelanstieg drehen, ist es kaum möglich, mit diesem Budget Untersuchungen zum lokalen Anstieg des Meeresspiegels aus anderen Gründen zu unternehmen. Die Ursachen lokaler Veränderungen des Meeresspiegels sind vielfältig und haben sehr häufig tektonische oder bodenmechanisch-hydrogeologische Ursachen.
Es wäre sicherlich eine gute Idee, Geowissenschaftlern Forschungsgelder zur Verfügung zu stellen, um die komplexen Zusammenhänge zu untersuchen und dadurch besser zu verstehen. Denn nur wenn man valide Daten statt Computersimulationen hat, können die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Mich als Geologen würde das jedenfalls freuen.
Meine Seite braucht Ihre Unterstützung!
Wenn Sie weiter Artikel wie diesen lesen wollen, helfen Sie bitte mit! Sichern Sie kritischen, unabhängigen Journalismus, der keine GEZ-Gebühren oder Steuergelder bekommt, und keinen Milliardär als Sponsor hat. Und deswegen nur Ihnen gegenüber verpflichtet ist – den Lesern!
1000 Dank!
Aktuell sind (wieder) Zuwendungen via Kreditkarte, Apple Pay etc. möglich – trotz der Paypal-Sperre:
Über diesen LinkAlternativ via Banküberweisung, IBAN: DE30 6805 1207 0000 3701 71 oder BE43 9672 1582 8501
BITCOIN Empfängerschlüssel auf Anfrage
Diejenigen, die selbst wenig haben, bitte ich ausdrücklich darum, das Wenige zu behalten. Umso mehr freut mich Unterstützung von allen, denen sie nicht weh tut.
Mein aktuelles Video
Stinke-Socken vom Vorgänger und Fenster-Öffnungs-Verbot – „Dschungelcamp“-Gefühle im Berlin-Urlaub.
Mein aktueller Livestream
Wie Habeck über Stalins Schnurrbart stolperte – und Esken sich dringt verriet.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Gastbeiträge geben immer die Meinung des Autors wieder, nicht meine. Und ich bin der Ansicht, dass gerade Beiträge von streitbaren Autoren für die Diskussion und die Demokratie besonders wertvoll sind. Ich schätze meine Leser als erwachsene Menschen und will ihnen unterschiedliche Blickwinkel bieten, damit sie sich selbst eine Meinung bilden können.
Uta Böttcher ist Diplom-Geologin mit dem Fachbereich angewandte Geologie, speziell Hydrogeologie. Sie hat als Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes an der Universität Heidelberg studiert und in der Forschung sowie in der freien Wirtschaft gearbeitet.
Bild: Screenshot Youtube-Video WELTmehr zum Thema auf reitschuster.de