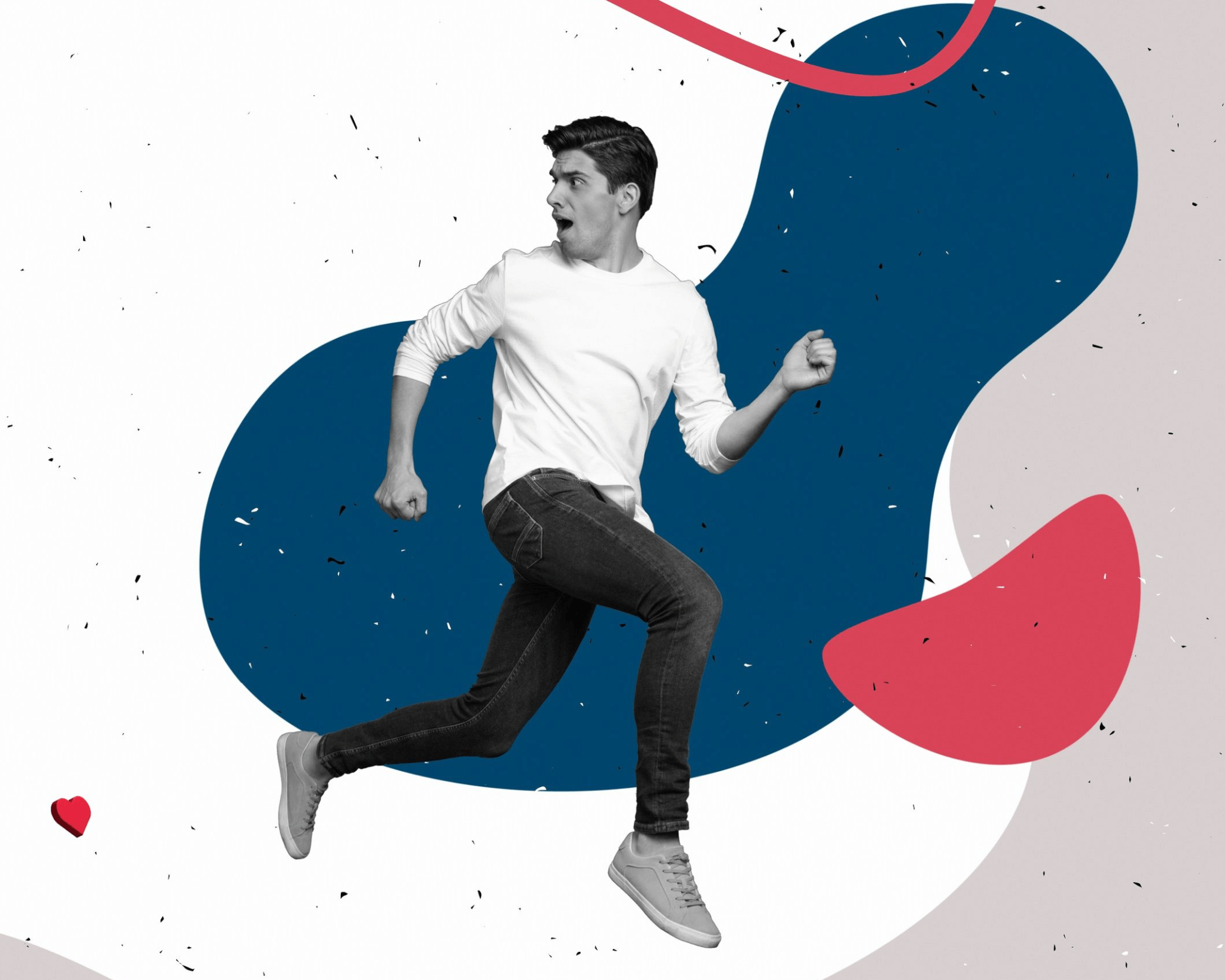Von Ekaterina Quehl
Obwohl ich in meinen fast 20 Jahren des Lebens in Deutschland nicht behaupten kann, dass ich speziell als Ausländerin benachteiligt wurde, beobachte ich hier fast täglich, wie der Umgang der Menschen miteinander allmählich verwest. Unabhängig von ihrer Herkunft. Als ob sie verlernen, was es eigentlich heißt, mit gesundem Verstand in bestimmten Lebenslagen nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln. Mein Eindruck ist zudem, dass besonders diejenigen, die am lautesten im Chor mit Politik und Medien über Toleranz gegenüber allen Menschengruppen, Offenheit gegenüber allen Meinungen, besseren Schutz für alle Schutzbedürftigen und größere Hilfe für alle Hilfesuchenden singen, am wenigsten Vorstellung haben, was all diese Begriffe eigentlich bedeuten.
Unser Alltag kommt mir vor, als ob er mit einer Fassade aus Konformismus ummantelt wäre. Die man wunderbar mit all den heute populären Parolen bemalen kann und hinter der man eigene Weltvorstellungen sehr gut verstecken kann – unter anderem auch vor sich selbst. Die aber dann unweigerlich nach außen kommen, wenn eine konkrete Lebenssituation von einem das eigene „Menschsein“ herausfordert.

Mein Nachbar Milan (Name geändert) ist vor 6 Jahren mit seiner Frau und zwei Kindern aus Serbien nach Deutschland gekommen. Beide arbeiten, beide sprechen Deutsch und waren nie auf Staatshilfe angewiesen. Die Geschichten, die sie mir erzählen, lassen mich nach Atem schnappen. Doch ich denke nicht, dass sie mit ihnen passiert sind, weil sie Ausländer sind. Vielmehr spiegeln sie für mich den Alltag im heutigen Deutschland wider – unabhängig davon, wer mit welcher Herkunft ihn hier lebt.
Milan arbeitete in einer Werkstatt und sein Kollege hat unglücklicherweise ein Arbeitsgerät so benutzt, dass Milans Finger abgeschnitten wurde. Der Kollege fiel sofort in Ohnmacht, Milan aber nicht. In einem Schockzustand hob er seinen Finger auf, legte ihn in eine Tüte und ließ sich von einem anderen Kollegen in die Notaufnahme eines Krankenhauses in der Nähe fahren. Er dachte, so sei es viel schneller und unkomplizierter, als einen Rettungsdienst zu rufen.
In der Notaufnahme ging er sofort zum Empfang. Die Mitarbeiterin dort sei die Ruhe selbst gewesen und rührte sich nicht von der Stelle. „Und was wollen Sie hier?“, fragte sie, nachdem Milan – kaum noch bei Bewusstsein – ihr über seinen Unfall erzählte. „Da kann man nix machen. Wenn es weg ist, ist es weg“, antwortete sie ihm.
Nach einer Diskussion darüber, dass etwas zu machen wohl doch sinnvoll wäre, zum Beispiel erste Hilfe zu leisten oder vielleicht zu versuchen, den Finger zu retten, wenn Milan ihn schon in einer Tüte dabei habe, händigte ihm die Mitarbeiterin Unterlagen aus. „Bitte ausfüllen!“, sagte sie. „Kann ich das nicht später machen?“, frage er sie. „Nein, sonst können wir Ihnen nicht helfen.“ Mit Ach und Krach und Hilfe seines Kollegen füllte Milan die Unterlagen aus. Es sei notwendig gewesen, weil man selbst in die Notaufnahme gekommen sei und nicht mit einem Rettungswagen, erklärte mir Milan.
Als Milan nun endlich zum Arzt durfte, sah er ihn umgeben von einer Gruppe Studenten. Er habe sich Zeit gelassen, ihnen ausführlich zu erklären, welche Art Wunde sein Patient habe und auf welche Verletzung die Ränder der Wunde hinweisen. Nach dieser Theorie-Stunde wurde Milan endlich behandelt und sein Finger konnte gerettet werden, gleichwohl mit Folgen: Milan kann ihn nur eingeschränkt bewegen. Als er den Vorfall als Arbeitsunfall melden wollte, hat ihm sein Arbeitgeber klargemacht, dass er eigentlich selbst schuld sei: Er solle doch bitte die Finger nicht dahin stecken, wo sie nicht hingehören.
Die Geschichte ist absurd und sicher ein Einzelfall. Aber die Häufigkeit, mit der ich oder meine Angehörigen, Freunde und Bekannte solche „Einzelfälle“ erleben, oder ich sie von unseren Lesern erfahre, weist darauf hin, dass es längst der Alltag geworden ist. Ein Alltag, in dem wir alle leben. Und solange wir es zulassen, dass er hinter der Fassade mit den von Moralaposteln bemalten Parolen und Belehrungen zum schönen und richtigen Leben versteckt bleibt, bleibt er unsere eigene Wahl.
Ausschreibung zur Fahndung durch die Polizei, Kontenkündigungen, Ausschluss aus der Bundespressekonferenz: Wer in Deutschland kritisch berichtet, sieht sich Psychoterror ausgesetzt. Und braucht für den Spott der rot-grünen Kultur-Krieger nicht zu sorgen. Ich mache trotzdem weiter. Auch, weil ich glaube, dass ich Ihnen das schuldig bin. Entscheidend fürs Weitermachen ist Ihre Unterstützung! Sie ist auch moralisch sehr, sehr wichtig für mich – sie zeigt mir, ich bin nicht allein und gibt mir die Kraft, trotz der ganzen Schikanen weiterzumachen! Ganz, ganz herzlichen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung, und sei es nur eine symbolische!
Aktuell sind (wieder) Zuwendungen via Kreditkarte, Apple Pay etc. möglich – trotz der Paypal-Sperre: über diesen Link. Alternativ via Banküberweisung, IBAN: DE30 6805 1207 0000 3701 71. Diejenigen, die selbst wenig haben, bitte ich ausdrücklich darum, das Wenige zu behalten. Umso mehr freut mich Unterstützung von allen, denen sie nicht weh tut.
Mein aktuelles Video:

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben immer die Meinung des Autors wieder, nicht meine. Ich schätze meine Leser als erwachsene Menschen und will ihnen unterschiedliche Blickwinkel bieten, damit sie sich selbst eine Meinung bilden können.
 Ekaterina Quehl ist gebürtige St. Petersburgerin, russische Jüdin, und lebt seit über 19 Jahren in Berlin. Pioniergruß, Schuluniform und Samisdat-Bücher gehörten zu ihrem Leben wie Perestroika und Lebensmittelmarken. Ihre Affinität zur deutschen Sprache hat sie bereits als Schulkind entwickelt. Aus dieser heraus weigert sie sich hartnäckig, zu gendern. Mit 27 kam sie nach einem abgeschlossenen Informatik-Studium nach Berlin und arbeitete nach ihrem zweiten Studienabschluss viele Jahre als Übersetzerin, aber auch als Grafikerin. Mittlerweile arbeitet sie für reitschuster.de.
Ekaterina Quehl ist gebürtige St. Petersburgerin, russische Jüdin, und lebt seit über 19 Jahren in Berlin. Pioniergruß, Schuluniform und Samisdat-Bücher gehörten zu ihrem Leben wie Perestroika und Lebensmittelmarken. Ihre Affinität zur deutschen Sprache hat sie bereits als Schulkind entwickelt. Aus dieser heraus weigert sie sich hartnäckig, zu gendern. Mit 27 kam sie nach einem abgeschlossenen Informatik-Studium nach Berlin und arbeitete nach ihrem zweiten Studienabschluss viele Jahre als Übersetzerin, aber auch als Grafikerin. Mittlerweile arbeitet sie für reitschuster.de.
Mehr von Ekaterina Quehl auf reitschuster.de