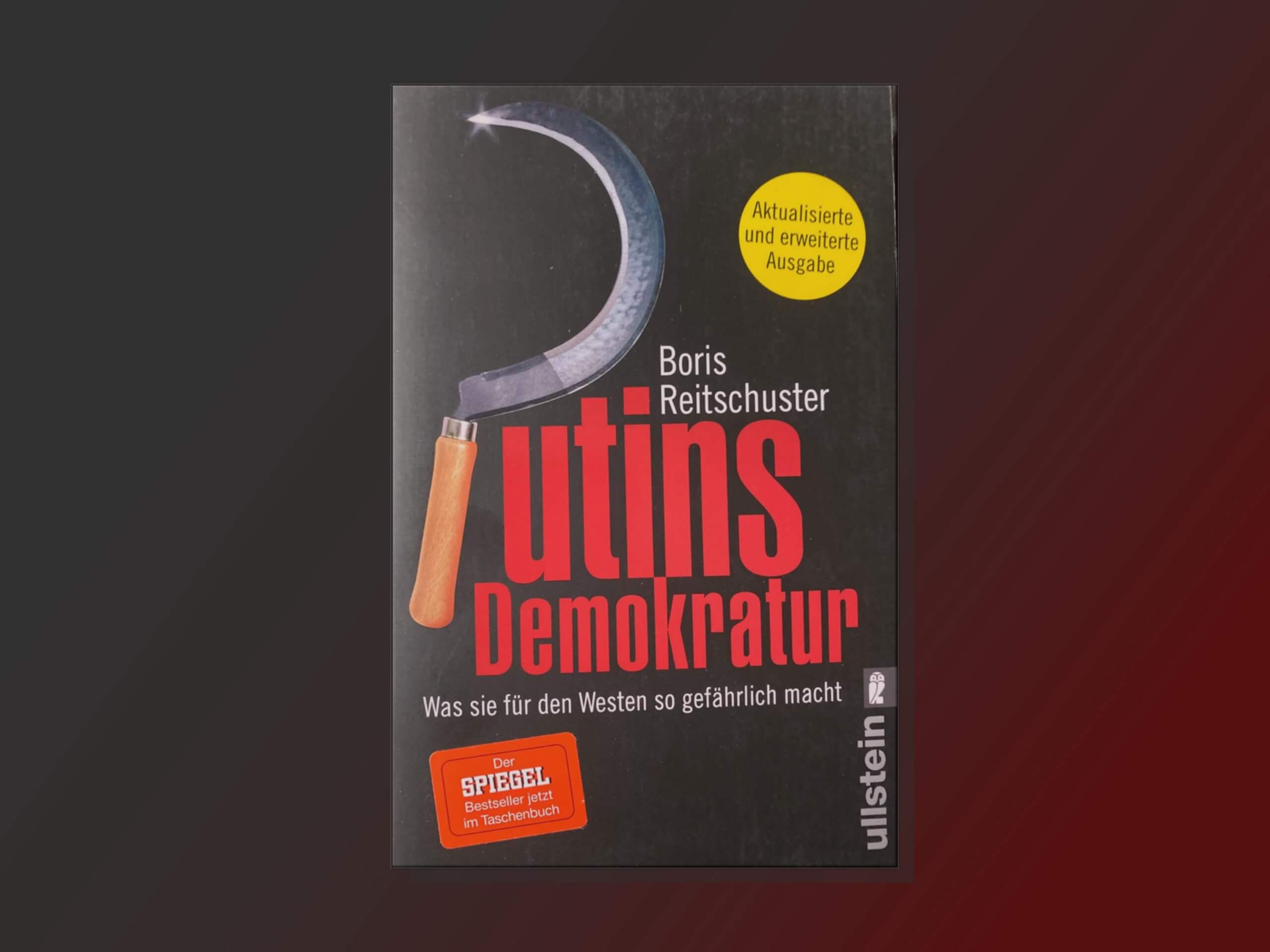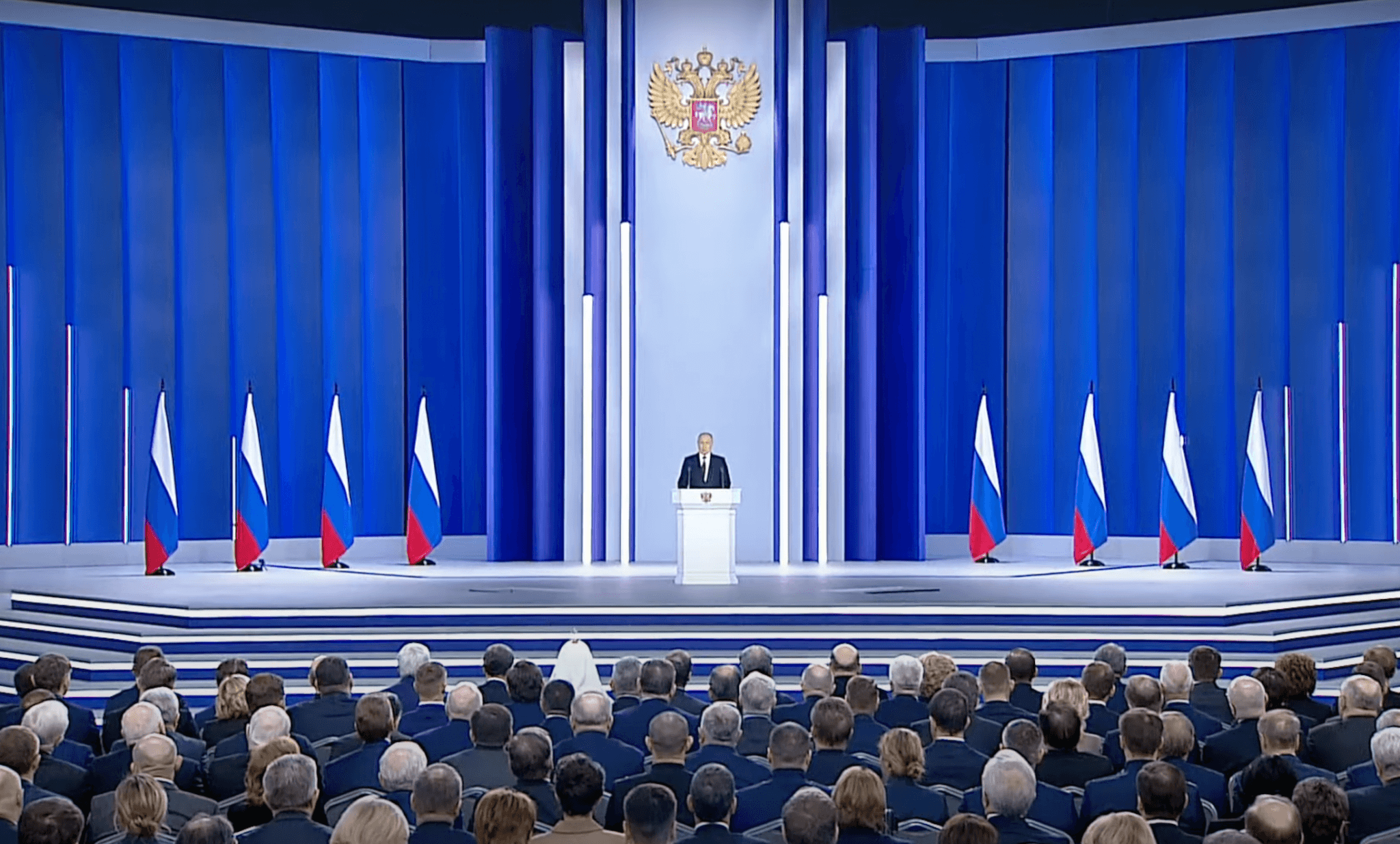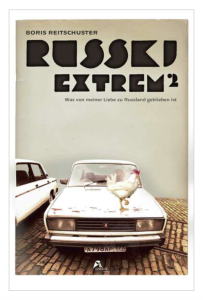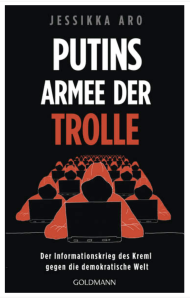Weil ich immer wieder auf meine Kritik an Putin und seinem System angesprochen werde, habe ich mich entschlossen, den Vertragsverlag für mein Buch „Putins Demokratur“ nicht zu verlängern – damit ich es Ihnen, liebe Leser, kostenlos zur Verfügung stellen kann. Stück für Stück. Die genauen Gründe für meine Entscheidung können Sie hier in meiner Einleitung zum ersten Beitrag dieser Serie finden. Lesen Sie heute Teil 3 – das Kapitel „Mit Stalin in die Zukunft – die verratene Revolution“. Die darin enthaltenen Warnungen aus dem Jahr 2006 haben sich leider mehr als bewahrheitet.
Der »Dschungel« ist grau und baufällig. Hinter den alten Mietshäusern in der Baskowgasse, einem alten Arbeiterviertel in Sankt Petersburg, versteckt sich ein Labyrinth aus düsteren Hinterhöfen mit überquellenden Mülltonnen. Die Jahrzehnte haben einen tiefen verstaubten Schleier auf die abblätternden Fassaden aus dem 19. Jahrhundert gelegt, nur wenige Autominuten entfernt von Petersburgs Prachtbauten am Newskiprospekt. Drinnen in den modrigen Treppenhäusern machen Kinder Jagd auf Ratten. Unten auf der Straße gibt das Gesindel den Ton an. Unrasierte, dreckige Jugendliche mit billigen Portwein-Flaschen und Zigaretten schlagen die Zeit tot. Und nicht nur die Zeit: In den Hinterhöfen der Baskowgasse herrscht das Faustrecht. Nur wer stark ist, hat etwas zu sagen. Nachgiebigkeit ist Schwäche.
Und Schwäche kann ins Auge gehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das muss auch ein kleiner Junge erfahren, der hier in der Baskowgasse aufwächst und der etwas schmächtig ist für diesen »Dschungel«. Wolodja nennen sie ihn. Sein Vater ist ein stramm kommunistischer Fabrikarbeiter. Er verprügelt den Kleinen manchmal mit dem Gürtel und tut sich schwer, väterliche Gefühle zu zeigen. Wolodja, ein Blondschopf mit stechenden blauen Augen, denkt nie über die Folgen nach, wenn eine Schlägerei ansteht. Wenn es nötig ist, haut er direkt drauf los. Ins Gesicht. Wolodja kratzt und beißt, reißt seinen Gegnern büschelweise die Haare aus. Meist aber ist er es, der die Prügel einsteckt. Blaue Flecken und Schrammen zeugen regelmäßig von seinen Kämpfen. Er sei »nicht kräftig, aber sehr frech«, wolle immer beweisen, dass er den anderen überlegen sei, klagt seine Lehrerin.
Noch vor der Einschulung macht Wolodja einen Ausflug in einen Nachbarhof. Und begeht einen folgenschweren Fehler. Er legt sich mit einem anderen Jungen an, schätzt ihn als »Jämmerling« ein und beleidigt ihn – grundlos. Doch der vermeintliche Schwächling entpuppt sich als älter und stärker – und vermöbelt Wolodja nach Strich und Faden. Es sind die ersten kräftigen Prügel, die Wolodja auf der Straße bekommt. Und sie prägen sich ein. So sehr, dass der kleine Junge seine Lehren daraus zieht. Eine lautet: »Egal, ob man im Recht ist oder nicht – man muss stark sein, um die Möglichkeit zu haben, etwas zu erwidern!«
Mehr als vier Jahrzehnte sind seitdem vergangen, und der Junge aus dem Petersburger Hinterhof erinnert sich noch immer an die Lebensweisheiten von damals. Viele der Gossenjungen von einst sind inzwischen völlig versoffene, heruntergekommene Gestalten; einige saßen zwischenzeitlich im Gefängnis. Wolodja dagegen sitzt im Kreml – und erzählt seinem Biographen die Geschichte der Baskowgasse. Aus dem kleinen, schmächtigen Jungen ist der mächtige Präsident Russlands geworden: Wladimir Putin. Im Hinterhof aufzuwachsen, das sei wie im Dschungel zu überleben, sagt der Staatschef: Die Prügel von damals seien eine »erste, wichtige Straßen-Universität« gewesen.
Stark sein, um Recht zu bekommen. Wie ein roter Faden durchzieht das Streben nach Stärke Putins Lebensweg: Der Knabe beschließt, Judo zu lernen. Der Jugendliche geht zum KGB. Beschattet Ausländer in Petersburg. Kommt später als Agent in die DDR. Und ausgerechnet dort, in Deutschland, holt ihn die Schwäche wieder ein. Die Schwäche kommt mit Glasnost und Perestroika. Während seine Landsleute dank Gorbatschows Reformen aufatmen, lebt Wladimir Putin in Erich Honeckers Reich. Und er ist sehr angetan von der kleinen, heilen DDR-Welt. Die Bürgersteige sind sauberer als in seiner Heimat, und vor den Geschäften stehen nicht so oft Warteschlangen wie daheim in der Sowjetunion. Doch dann erreicht die Perestroika auch die DDR. Und sie bringt Putins ruhige, kleine Welt um die KGB-Residenz in Dresden-Loschwitz in Gefahr.
»Als die Berliner Mauer fiel, wurde klar, das ist das Ende. Es war ein schreckliches Gefühl, dass das Land, das fast zur Heimat geworden war, aufhörte zu existieren«, erinnerte sich Putin später: »Um ehrlich zu sein, tat es mir leid, dass wir die Einflusszone der Sowjetunion in Europa verloren hatten.« Tag und Nacht musste der heutige Präsident mit einem Genossen KGB-Akten vernichten, die eigene Arbeit von Jahren: »Wir mussten so viel verbrennen, dass der Ofen platzte.« Die Gesellschaft, wundert sich Putin noch im Jahr 2000 als Staatschef, sei damals »völlig verstört« gewesen und habe »im Geheimdienst ein Monster« gesehen.
An einem kühlen Abend im Dresdener Herbst 1989 wird die politische Wende endgültig zur Bedrohung. Eine erzürnte Menschenmasse hat gerade die Stasi-Zentrale an der Elbe gestürmt. Dann marschiert sie weiter durch die dunkle Stadt. Nach Loschwitz. Zu einer Villa: der Residenz des KGB. Die aufgebrachten Bürger wollen die Unterlagen des russischen Geheimdienstes in ihre Gewalt bringen. Weil sein Chef weggefahren ist, hat Wladimir Putin an diesem Abend das Kommando. Er ist 37 Jahre alt und seine Liebe zum deutschen Bier ist inzwischen an seiner Figur abzulesen, die er bis dahin mit Sport immer gut in Form hielt. Putin tut so, als sei er Dolmetscher, und spricht mit den Menschen. Wenn er den Demonstranten nachgibt und die Unterlagen herausrückt, kann man ihn vor ein sowjetisches Kriegsgericht stellen. Wenn er sich weigert und die Stellung hält, droht ein blutiger Aufstand. Die Situation ist so dramatisch, dass Putin die wenigen Männer, die seinem Befehl unterstehen, mit der Kalaschnikow im Anschlag in den Fenstern Stellung beziehen lässt. Eher werde er sterben als Geheimunterlagen herauszugeben, sagt er. Und tut in seiner Not das, was das Sowjetsystem ihm als Offizier für solche Situationen eingebläut hat: Er greift zum Telefonhörer und hofft, dass andere eine Entscheidung treffen. Er bittet die Westgruppe der Streitkräfte um Beistand.
Die Antwort muss ihn zutiefst erschüttert haben. Moskau schweige, und ohne Erlaubnis aus der Hauptstadt könne man gar nichts unternehmen, sagt der Kommandeur am anderen Ende der Leitung. Nichts passiert. Draußen steht die Menge, drinnen Wladimir Putin mit seinen paar Leuten und weiß nicht, wie lange er die Lage noch unter Kontrolle halten kann. Der Staat, der so mächtig war, der ihm einst alles gab, ist plötzlich machtlos, versagt ihm jede Hilfe. Lässt ihn Blut und Wasser schwitzen. Erst nach Stunden schickt Moskau endlich Unterstützung; die Soldaten jagen die Menge schnell auseinander. Bis heute klingen sie nach, diese Worte: »Moskau schweigt.« Sie haben ihn schwer getroffen, bekennt Putin mehr als ein Jahrzehnt später: »Mir war so, als ob es unser Land nicht mehr gibt. Mir wurde klar, dass die Sowjetunion erkrankt ist. An einer tödlichen, unheilbaren Krankheit mit dem Namen Lähmung. Die Lähmung der Macht.«
Gut zehn Jahre nach jenem schicksalsträchtigen Abend in Dresden, am 31. Dezember 1999, gelangt Wladimir Putin selbst an die Spitze des russischen Staates. Im Kreml angekommen, tut er alles, um die »Lähmung der Macht« zu beenden, um den Staat wieder stark zu machen. Freiheit und Glasnost erlebte er mehr als Bedrohung denn als Chance. Die dramatischen Momente von Dresden hat er bis heute nicht vergessen. Mehr als alle anderen Erfahrungen werden sie künftig seine Politik bestimmen.
In seinen Reden betont der Kreml-Chef stets seine demokratische Gesinnung. Kritiker halten dagegen, er bringe Russland auf einen autoritären Kurs, der an die Sowjetunion erinnere. Putin führt die rote Militärflagge mit dem Sowjetstern ebenso wieder ein wie die sowjetische Nationalhymne, mit neuem Text vom alten Autor. An den Denkmälern längs der Kremlmauer lässt er den Städtenamen Wolgograd herausmeißeln und durch Stalingrad ersetzen.
Als die baltischen Staaten und Polen zum Jahrestag des Sieges über Hitler-Deutschland im Mai 2005 darauf verweisen, dass mit der Niederlage des Dritten Reiches für sie eine neue Okkupation durch die Rote Armee begonnen habe, lösen diese Worte in Moskau einen Sturm der Entrüstung aus. Schon 1994 verließ Putin als Vizebürgermeister von Sankt Petersburg mit einem lautstarken Türknall eine internationale Konferenz, als Estlands Präsident die Russen als »Okkupanten« bezeichnete. Im Mai 2005 empfiehlt Putin, dessen Großvater einst Stalin auf dessen Datscha bekochte, »Historikern, die die Geschichte umschreiben wollen, erst mal Bücher lesen zu lernen«. In den Unterrichtswerken, die das russische Bildungsministerium neuerdings vorschreibt, erscheint Stalin wieder als »großer Feldherr«. Ein Schulbuch, das über Stalins Säuberungen berichtet und die Rolle des Diktators im Krieg ohne falschen Patriotismus hinterfragt, wird 2003 aus den Schulen verbannt. Schritt für Schritt wird, von Lehrbüchern für Hochschulen oder Schulen bis hin zu Gedenktagsreden, eine tragikfreie Version der sowjetischen Geschichte verbreitet, in der Menschenleben, Freiheit und persönliche Würde kaum eine Rolle spielen. Stattdessen werden Heimtücke, Verrat, Niedertracht und Grausamkeit erneut gerechtfertigt, solange sie im Namen des Imperiums geschehen.
Natürlich habe es in der Geschichte Russlands »problematische« und »schreckliche« Seiten gegeben, sagt Putin bei einer Konferenz mit Geschichtslehrern im Juni 2007, auf der es unter anderem um neues Unterrichtsmaterial geht, das die Geschichtsbücher der neunziger Jahre ablösen soll: »Aber in anderen Ländern, so ist gesagt worden, war es noch schlimmer.« Der Präsident deutet an, dass die atomaren Schläge der USA auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki gegen Ende des Zweiten Weltkriegs sowie ihr Luftkrieg gegen Vietnam mit chemischen Mitteln schlimmer waren als der stalinistische Staatsterror. »Wir haben nicht Atomwaffen gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt. Wir haben nicht Tausende von Quadratkilometern mit Chemikalien eingesprüht oder auf ein kleines Land siebenmal mehr Bomben als im gesamten Großen Vaterländischen Krieg abgeworfen«, sagt Putin.
»Großer Vaterländischer Krieg«, so wird der Zweite Weltkrieg in der Sowjetunion und Russland genannt. »Wir hatten auch nicht andere schwarze Seiten, wie den Nationalsozialismus zum Beispiel«, fügt der Kreml-Chef in Anspielung auf Deutschland hinzu. Zu den alten Geschichtslehrbüchern aus den neunziger Jahren heißt es auf der Konferenz, darin werde die Geschichte des 20. Jahrhunderts als einzige Folge von Katastrophen dargestellt, doch die Errungenschaften würden verschwiegen. Man müsse zwar Fehler eingestehen, aber, um die Autorität des Staates neu aufzubauen, auch die Erfolge sehen – die von Stalin eingeschlossen. »Man darf nicht erlauben, dass sie uns Schuldgefühle anhängen«, appelliert Putin an die Lehrer – und meint mit dem »sie« den Westen. Seine Erklärung, woher die angeblich zu düstere Darstellung der Geschichte Russlands in den alten Büchern herrührt, lautet so: »Verstehen Sie, viele, viele Lehrbücher wurden von Leuten geschrieben, die für ausländisches Geld arbeiten. Und wer bezahlt, der bestellt die Musik.«
Parlamentspräsident Boris Gryslow, ein enger Vertrauter des Präsidenten, dem Kritiker unterstellen, er habe zu nichts eine Meinung, bevor er sich nicht mit dem Präsidenten abgestimmt habe, bezeichnet Stalin zu dessen 125. Geburtstag am 21. Dezember 2004 als »herausragenden Mann«, der »viel für den Sieg der UdSSR im Großen Vaterländischen Krieg« geleistet habe. Der Sowjetführer, so Gryslow, habe großes Ansehen in der Anti-Hitler-Koalition genossen und eine entscheidende Rolle bei den Verhandlungen in Jalta und Teheran gespielt. »Die Übertreibungen in der Innenpolitik, die es aber meines Erachtens gab, sind ohne Zweifel keine Zierde für ihn.« Anscheinend meint Gryslow damit die Gräueltaten Stalins, den Historiker für den Tod von Millionen seiner Landsleute verantwortlich machen.
Hinter der Nostalgiewelle steckt offenbar politisches Kalkül. Stalin steht für Stärke, für die Sowjetunion als Weltmacht, die überall gefürchtet, aber auch geachtet war. Weil die russische Realität auch unter Putin nicht so viel Stärke und Glanz bietet, wie es die patriotische Propaganda gern glauben machen möchte, nutzt der Kreml die Vergangenheit, um die Gegenwart aufzupolieren. Dabei kommt den Regierenden entgegen, dass die Sehnsucht nach seligen Sowjetzeiten immer noch weit verbreitet ist. Um die Ursachen zu verstehen, ist ein kurzer Blick in die jüngste russische Geschichte notwendig.
Die Fortsetzung finden Sie in Kürze hier auf meiner Seite: „Die Herrschaft der Exkremente“.
Den vorherigen, zweiten Text – „Der Gas-Schock – Moskaus Warnschuss“ – finden Sie hier.
Den ersten Text der Buchveröffentlichung finden Sie hier.
Auf Ihre Mithilfe kommt es an!
Auf meiner Seite konnten Sie schon 2021 lesen, was damals noch als „Corona-Ketzerei“ galt – und heute selbst von den großen Medien eingestanden werden muss. Kritischer Journalismus ist wie ein Eisbrecher – er schlägt Schneisen in die Einheitsmeinung.
Dafür muss man einiges aushalten. Aber nur so bricht man das Eis. Langsam, aber sicher.
Diese Arbeit ist nur mit Ihrer Unterstützung möglich!
Helfen Sie mit, sichern Sie kritischen, unabhängigen Journalismus, der keine GEZ-Gebühren oder Steuergelder bekommt, und keinen Milliardär als Sponsor hat. Und deswegen nur Ihnen gegenüber verpflichtet ist – den Lesern!
1000 Dank!
Per Kreditkarte, Apple Pay etc.Alternativ via Banküberweisung, IBAN: DE30 6805 1207 0000 3701 71 oder BE43 9672 1582 8501
BITCOIN Empfängerschlüssel auf Anfrage
Mein aktuelles Video
Ein Blick auf Nordkorea: (M)eine erschütternde Reise in die Zukunft – in den grünen (Alb-)traum
Mehr zu diesem Thema auf reitschuster.de