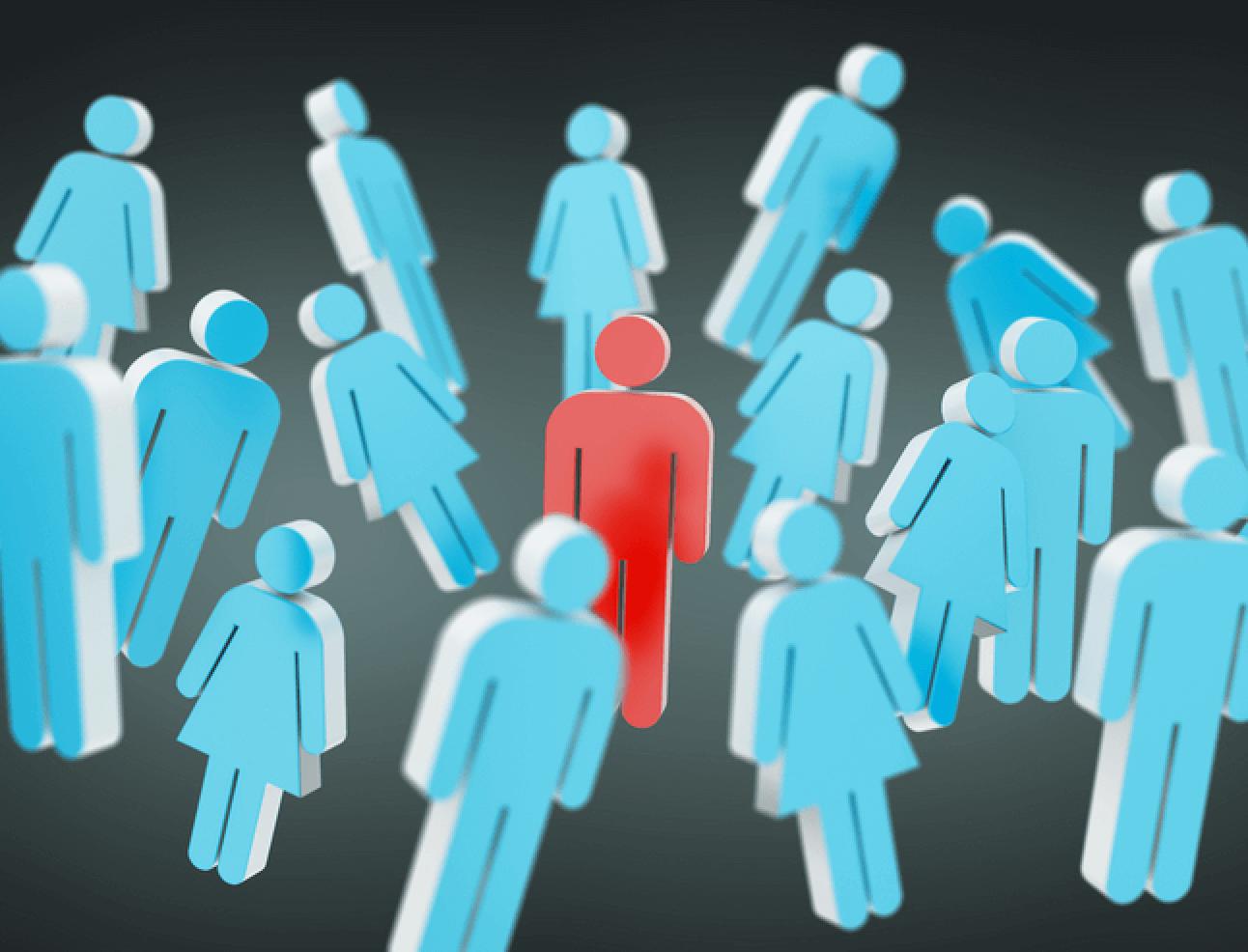Ein Gastbeitrag Von Thomas Rießinger
Franz Josef Strauß war ein Mann klarer Worte, der aus seiner Einschätzung des politischen Gegners kein Geheimnis machte: „So wie ein Hund unfähig ist, sich einen Wurstvorrat anzulegen“, meinte er einmal in Anlehnung an den Ökonomen Josef Schumpeter, „sind Sozialdemokraten unfähig, Geldvorräte anzulegen.“ Manchem Sozialdemokraten seiner Zeit mag er damit Unrecht getan haben, denn damals gab es auch in den höheren Rängen der SPD noch Politiker, die das Geld nicht so hemmungslos zum Fenster hinaus warfen, wie das heute üblich geworden ist; ich darf nur auf Lars Klingbeil und Bärbel Bas hinweisen, denen ich nicht einmal den Wurst-, geschweige denn den Geldvorrat anvertrauen würde.
Aber nicht nur Geld sollte man den Sozialdemokraten heutiger Prägung nur sehr bedingt überlassen, auch die Organisation der Demokratie – ich spreche natürlich nicht von „unserer Demokratie“, sondern von Demokratie – ist bei ihnen nicht in den allerbesten Händen, weil ihre Hände gerne das ausführen wollen, was ihre Ideologie ihnen diktiert. Nicht immer geht das gut. So hat man beispielsweise Anfang des Jahres 2019 in Brandenburg mit der Zustimmung von SPD, SED und Grünen ein Paritätsgesetz beschlossen, „das von Parteien bei Landtagswahlen gleich viele Frauen und Männer als Kandidaten verlangt.“
2020 war der Spaß vorbei. Das Brandenburger Verfassungsgericht befand die gesetzliche Verpflichtung der Parteien, „ihre Kandidatenlisten bei Landtagswahlen mit abwechselnd gleich vielen Frauen und Männern zu besetzen“, für verfassungswidrig. „Durch das Paritätsgesetz entziehe der Gesetzgeber dem demokratischen Willensbildungsprozess einen wesentlichen Teil, indem er auf die Zusammensetzung der Listen Einfluss nehme, so die Richter.“ Abgeordnete seien dem ganzen Volk gegenüber verantwortlich. „Diesem Verständnis widerspreche die Idee, dass sich in der Zusammensetzung des Parlaments auch diejenige der Bevölkerung in ihren vielfältig einzuteilenden Gruppen, Schichten oder Klassen widerspiegeln soll.“ Ein ähnliches Thüringer Gesetz, beschlossen unter einer Landesregierung aus SED, SPD und Grünen, hatte schon zuvor das dortige Verfassungsgericht beerdigt.
In Berlin mochte man das gar nicht. Dort äußerte die stellvertretende Landesvorsitzende der SPD erzürnt, man werde „nach den herben juristischen Rückschlägen durch die Urteile von Thüringen und Brandenburg in Berlin mit einem rechtssicheren Paritätsgesetz Vorreiter auf dem Weg zur gleichberechtigten Teilhabe von Männern und Frauen im Parlament werden.“
Das geschah im Oktober 2020. Gut Ding will Weile haben, doch inzwischen, mehr als fünf Jahre später, hat die Berliner SPD im Rahmen einer Klausurtagung der SPD-Fraktion des Berliner Abgeordnetenhauses tatsächlich eine neue Variante der parlamentarischen Parität vorgelegt, wenn auch nur auf prinzipieller Basis und ohne zu viele lästige Details. In einer „Teilresolution“ erfahren wir, worum es geht. „Frauen sind mehr als die Hälfte der Bevölkerung“, so lernen wir, „deshalb sollen Aufsichtsräte, Kontrollgremien und Jurys sowie Leitungspositionen in allen Bereichen, auch in der Berliner Kultur, im Einklang mit den Gleichstellungsgrundsätzen arbeiten und paritätisch besetzt werden. Diese Selbstverständlichkeit muss die Politik auch selbst vorleben.“ Mirjam Golm, die gleichstellungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, hat das noch einmal in ihre eigenen Worte gefasst: „Es geht darum, dass Frauen nicht länger automatisch hinten runterfallen.“ Und: „Am Ende muss das Parlament die Gesellschaft widerspiegeln – und da sind Frauen eben zu wenig sichtbar.“
Wer wollte dem widersprechen? Ich fürchte, recht viele. Von den Aufsichtsräten will ich nicht reden: Die pure Tatsache, dass sowohl Friedrich Merz als auch Karl Lauterbach Sitze in Aufsichtsräten hielten, beweist, dass man dort schon früher nicht auf Qualifikation geachtet hat; da kann man auch gerne noch ein qualifikationsbefreites Geschlechterkriterium einführen. Schwieriger wird es im Falle der „Leitungspositionen in allen Bereichen“. Leitungspositionen zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Inhaber etwas leiten. Zu diesem Zweck können ein paar Sachkenntnisse und etwas einschlägige Berufserfahrung nicht schaden, die allerdings nicht vom Geschlecht abhängen. Es spielt dabei keine Rolle, ob es sich um Männer oder Frauen handelt; besteht die Führungsriege eines Unternehmens oder einer Behörde ausschließlich aus Frauen, weil sie sich bewährt haben und die nötigen Fähigkeiten vorzuweisen wissen, ist mir das genauso recht wie eine Führungsetage, in der sich nur qualifizierte Männer aufhalten. Es geht um Qualifikation, nicht um Geschlecht, aber das zu verstehen, wäre in linken Kreisen eher ungewöhnlich. Im Übrigen fällt auf – wie immer, wenn es um Paritätsfragen geht –, dass man die Gesellschaft nur bei der Besetzung angenehmer Posten widerspiegeln möchte, sich aber der Frage, wie es wohl mit der Geschlechterparität auf dem Bau oder bei der Müllabfuhr aussieht, nicht so recht widmen mag.
Nach Auffassung der Berliner SPD muss also die Politik diese Selbstverständlichkeit vorleben. Ich erinnere daran, dass das Brandenburger Verfassungsgericht dem Gedanken widersprochen hat, „dass sich in der Zusammensetzung des Parlaments auch diejenige der Bevölkerung in ihren vielfältig einzuteilenden Gruppen, Schichten oder Klassen widerspiegeln soll“, weil das dem Prinzip, dass jeder Abgeordnete dem gesamten Volk gegenüber verantwortlich sei, widerspreche. Solche Kleinigkeiten können natürlich die SPD-Fraktion nicht beeindrucken. Doch warum sind die so inkonsequent? Wenn schon nach den Worten der Genossin Golm das Parlament die Gesellschaft widerspiegeln muss – eine Auffassung, die das Verfassungsgericht Brandenburg sehr deutlich bestritten hat –, dann darf man sich nicht auf Geschlechter beschränken. Glaubt man Wikipedia, so sind etwa 11% der Berliner evangelischer Konfession, ungefähr 7% sind katholisch und zu den Muslimen muss man ebenfalls etwa 11% der Bevölkerung zählen. Das Problem kleiner Konfessionen will ich gar nicht erst aufgreifen. Mindestens 130 Abgeordnete sollen sich im Hohen Haus versammeln, und da kann man wohl erwarten, dass sich auch die religiöse Gesellschaft hier widerspiegelt. 14 Protestanten braucht man dann schon, und ebenso viele Muslime, während sich die Katholiken mit neun Vertretern begnügen müssen. Mehr oder weniger dürfen es nicht sein, sonst ist das Prinzip des Widerspiegelns verletzt, auf das man bei der SPD so großen Wert legt.
Auch das reicht nicht. „53 Prozent der Berliner stufen sich als übergewichtig ein“, teilt uns die AOK mit, und das kann nur heißen, dass auch 53% der Abgeordneten das gleiche Schicksal teilen müssen: Berlin braucht 69 Übergewichtige in seinem Abgeordnetenhaus, aber eben auch nicht mehr, weil andernfalls wieder die Bevölkerung nicht korrekt widergespiegelt wird. Noch viele andere Kriterien sind denkbar, denen sich die SPD zuwenden sollte, damit sie sich nicht dem Vorwurf der sexualisierten Einseitigkeit aussetzt.
Aber nein, diese Art von Vielfalt interessiert die SPD-Fraktion nicht, denn es geht ja nur „darum, dass Frauen nicht länger automatisch hinten runterfallen.“ Der Gedanke erscheint seltsam, da er impliziert, dass Frauen immer und überall – automatisch eben – den Kürzeren ziehen und „hinten runterfallen“. An Belegen für diese gewagte These dürfte es fehlen. Glaubt die Genossin Golm, der wir diesen Satz verdanken, dass ihr Posten einem „Runterfallen“ entspricht und das auch noch nach hinten? Wir werden es nie erfahren.
Abstrakte Zielsetzungen sind das eine, konkrete Umsetzung das andere. Wie stellt man sich die neue Paritätsregel vor? So ganz genau weiß man das offenbar noch nicht, denn die Hinweise zur Konkretisierung bleiben einigermaßen vage. Mit Bezug auf Bundestagswahlen erfahren wir, das Bundesverfassungsgericht habe „akzeptiert, dass der Grundsatz der unmittelbaren Wahl zurücktreten kann, wenn dies notwendig ist, um die Begrenzung der Größe des Parlaments zu sichern. In diesem Zusammenhang hat es ausdrücklich für verfassungsgemäß erklärt, dass Erststimmenergebnisse unter bestimmten Bedingungen keine ausschlaggebende Wirkung entfalten müssen. Das heißt: Es ist möglich, dass eine direkt gewählte Person nicht ins Parlament einzieht, weil ihre Partei gemäß der Zweitstimmenergebnisse im Parlament überrepräsentiert wäre.“ Das ist so richtig wie bedauerlich, denn die aktuellen Wahlmodalitäten für den Bundestag sehen vor, dass eigentlich gewonnene Direktmandate nicht angetreten werden können, falls dadurch mehr Abgeordnete einer Partei ins Parlament einziehen, als es das Ergebnis der Zweitstimmen erlaubt.
Offenbar fühlt man sich in der Berliner SPD-Fraktion von dieser Rechtsprechung aufs Schönste inspiriert. „Aus unserer Sicht lässt sich diese verfassungsrechtliche Abwägung auf die Frage der Gleichberechtigung übertragen. Wenn der Gesetzgeber aus Gründen der Funktionsfähigkeit des Parlaments in Wahlrechtsgrundsätze eingreifen darf, dann ist dies erst recht zulässig, um das verfassungsrechtliche Gebot aus Artikel 3 des Grundgesetzes und Artikel 10 der Verfassung von Berlin wirksam durchzusetzen.“ Ob das nun wirklich „erst recht zulässig“ ist, lasse ich dahingestellt sein, denn meine Frage lautet: Wie geht das in der Praxis? Die Bundestagsregel kann man sich etwa so vorstellen: Stehen einer Partei nach ihrem Zweitstimmenergebnis 100 Sitze zu, während sie 105 Wahlkreise direkt für sich verbuchen konnte, dann werden fünf dieser 105 Direktmandate nicht vergeben, wobei man sich an den schlechtesten Ergebnissen in den Wahlkreisen orientiert.
Im Bundestag lässt man also schlicht Direktmandate wegfallen, wenn es zu viele davon gibt. Aber die Lage in Berlin ist eine andere, hier geht es nicht um Überhangmandate, sondern um Austausch. Nehmen wir an, eine Fraktion habe einen klaren Männerüberschuss bei ihren Direktmandaten im Berliner Abgeordnetenhaus. Dann müssten die überzähligen Männer auf ihr Mandat verzichten. Soll man es dann einfach unbesetzt lassen? Das könnte das Wahlergebnis verfälschen, denn die entsprechende Fraktion würde auf einmal kleiner werden. Oder soll man die frei gewordenen Mandate an Frauen vergeben, die über die Liste der Partei nicht ins Parlament gelangen konnten? Das ist prinzipiell möglich, aber nur, solange man hinreichend viele Frauen auf der Liste hat. Zumindest nach brandenburgisch-thüringischer Rechtsauffassung dürfte sich das aber einer gesetzlichen Regelung entziehen, weil es sich um einen wesentlichen Einfluss durch den Gesetzgeber auf die Zusammensetzung der Liste handelt. Was ist da zu tun? Sicher, man könnte die frei gewordenen Direktmandate durch Listenkandidatinnen konkurrierender Parteien besetzen lassen, so etwas entsprich ja dem Demokratieverständnis in „unserer Demokratie“, weil es die Mehrheitsverhältnisse gegen den Willen der Wähler verschieben würde. Ob auch das noch die Zustimmung eines Verfassungsgerichts fände, ist fraglich, aber beim Bundesverfassungsgericht durchaus vorstellbar. Am einfachsten wäre es selbstverständlich, wenn sich überzählige männliche Abgeordnete mithilfe des Selbstbestimmungsgesetzes zur Frau erklären.
In der Not wird man zweifellos einen windigen Gesetzentwurf zustande bringen, denn wir wissen: „Auch die Gutachter*innen des Senats, Prof. Dr. Frauke Brosius-Gersdorf, LL.M sowie Prof. Dr. Hubertus Gersdorf, kommen zu dem Ergebnis, dass ein Paritégesetz verfassungsrechtlich zulässig ist“, und wenn das die verhinderte Bundesverfassungsrichterin Brosius-Gersdorf, unterstützt von ihrem werten Gatten, meint, dann muss es wohl stimmen, sie hat ja bekanntlich ohnehin ein kreatives Verständnis vom Umgang mit Verfassungen. Was aber die wackeren Sozialdemokraten übersehen und übersehen müssen: Selbst für einen leidenschaftlichen Verfechter des Paritätsgedankens ist jede gesetzliche Regelung völlig überflüssig, sofern man bereit ist, sich auf seine eigene Verantwortung zu besinnen. Das kann man bei der SPD und auch bei anderen linken Parteien – es gibt ja kaum noch andere – leider nicht, da muss es immer der starke Staat richten, damit keiner Gefahr läuft, auf eigene Gedanken zu verfallen.
Denn was hält die so innig verbundenen Parteien CDU, SPD, SED und Grüne davon ab, das selbst innerhalb ihrer eigenen Kadidatenauswahl zu regeln? Man darf annehmen, dass die AfD sich nicht auf derartige Spielereien einlässt, aber das macht gar nichts. Nach letzten Umfragen wird die AfD knapp über 16% der Stimmen bei der nächsten Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus erzielen; im Zuge der Fünf-Prozent-Hürde sind das dann im Parlament selbst etwa 18% der Mandate. Seien wir nicht kleinlich, tun wir einfach so, als müsste man mit 25% der Sitze für die Partei der Geächteten rechnen. Na und? Nichts kann die Parteien „unserer Demokratie“ davon abhalten, Wahllisten nach dem Zwei-Drittel-Prinzip zu gestalten: Auf zwei Frauen folgt ein Mann, dann wieder zwei Frauen und ein Mann, und so weiter. Und da man auch die aussichtsreichen Wahlkreise zumindest ungefähr kennt, lässt sich bei der Auswahl der Direktkandidaten für diese aussichtsreichen Wahlkreise das gleiche Prinzip realisieren. Resultat: Die große Fraktion der Partei CDUSPDSEDGrüne besteht recht genau zu zwei Dritteln aus Frauen. Da ich davon ausgegangen bin, dass eben diese Kolossalfraktion drei Viertel aller Mandate erhalten wird, und da zwei Drittel von drei Vierteln genau die Hälfte ergibt, fügt sich alles problemlos zusammen: Mindestens die Hälfte der Abgeordneten wird weiblich sein. Und das ohne jeden gesetzlichen Zwang, durch eine freie Entscheidung der Parteien bei der Kandidatenauswahl. Sollte die AfD bei 19% der Sitze verharren, muss man nur zwei Drittel von 81% ausrechnen, um zu sehen, dass dann sogar 54% des Hohen Hauses aus Frauen bestehen wird. Und was geschieht, wenn auch die AfD die eine oder andere Frau ins Parlament schickt? Das schadet nichts, dann sind es eben ein paar mehr als nur 50% oder 54%, irgendwie muss man ja auch das historische Unrecht an den Frauen wieder ausgleichen.
Es bedarf keiner gesetzlichen Regelung. Wer Parität will, soll sie selbst herstellen, da man leicht nachrechnen kann, dass so etwas problemlos geht. Und wer sie nicht will, weil er das Prinzip für undemokratisch hält, der soll es eben bleiben lassen. So etwas bezeichnen manche als Freiheit.
Doch so denkt es nicht in der SPD. Freiheit, Verantwortung des Einzelnen ohne Zutun des Staates mag sie nicht; da könnten ja Dinge herauskommen, die ihr nicht ins Konzept passen. Besser gleich alles in ein Gesetz pressen, so überflüssig es auch sein mag, damit es kein Entkommen gibt.
Mit Franz Josef Strauß habe ich angefangen, mit ihm will ich auch aufhören. Das Vorgehen von Sozialisten hat er mit wenigen Worten beschrieben: „Das eigenartige an Sozialisten ist doch, dass sie ihre Lehren aus der Vergangenheit ziehen, in der Gegenwart versagen und für die Zukunft goldene Berge versprechen.“
Strauß ist vor fast 40 Jahren gestorben. Aber diese Beschreibung ist lebendiger als je zuvor.
HELFEN SIE MIT –
DAMIT DIESE STIMME HÖRBAR BLEIBT!
Im Dezember 2019 ging meine Seite an den Start – damals mit einem alten Laptop am Küchentisch. Heute erreicht sie regelmäßig mehr Leser als manch großer Medienkonzern. Und trotzdem: Der Küchentisch ist geblieben. Denn eines hat sich nicht geändert – meine Unabhängigkeit. Kein Verlag, keine Zwangsgebühren, keine Steuermittel. Nur Herzblut – und Sie.
Mein Ziel:
Sie kritisch durch den Wahnsinn unserer Zeit zu lotsen.
Ideologiefrei, unabhängig, furchtlos.
Ohne staatliche Subventionen, ohne Abo-Zwang, ohne Paywall. Niemand muss zahlen, um meine Seite zu lesen – aber ich bin unendlich dankbar für jede Unterstützung, die freiwillig kommt. Sie trägt mich. Denn sie zeigt: Ich habe Rückhalt. Und mein Einsatz – mit allen Risiken, Angriffen und schlaflosen Nächten – ist nicht vergeblich.
Der direkteste Weg (ohne Abzüge) ist die Banküberweisung:
IBAN: DE30 6805 1207 0000 3701 71.
Alternativ sind Zuwendungen via Kreditkarte, Apple Pay etc. möglich – allerdings werden dabei Gebühren fällig. Über diesen Link
Auch PayPal ist wieder möglich.
Nicht direkt – aber über Bande, dank Ko-fi:
Über diesen Link
(BITCOIN-Empfängerschlüssel: bc1qmdlseela8w4d7uykg0lsgm3pjpqk78fc4w0vlx)
Wenn Ihr Geld aktuell knapp ist – behalten Sie es bitte.
Mir ist wichtig, dass niemand zahlen muss, um kritisch informiert zu bleiben. Gleichzeitig bin ich umso dankbarer für jede freiwillige Geste, die keinen Verzicht abverlangt. Ob groß oder klein – Ihre Unterstützung ist für mich ein wertvolles Geschenk und trägt mich weiter.
Dafür: Ein großes Dankeschön– von ganzem Herzen!
Meine neuesten Videos und Livestreams
Zigtausende frieren – und unsere Medien spülen alles weich. Weil’s linker Terror war, nicht rechter.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Sicherheits-Placebo: Wie Augsburg sich mit Pollern vor Terror „schützt“ – aber nichts verhindert
Unheimlich daheim. Weihnachten in Augsburg
Gastbeiträge geben immer die Meinung des Autors wieder, nicht meine. Und ich bin der Ansicht, dass gerade Beiträge von streitbaren Autoren für die Diskussion und die Demokratie besonders wertvoll sind. Ich schätze meine Leser als erwachsene Menschen und will ihnen unterschiedliche Blickwinkel bieten, damit sie sich selbst eine Meinung bilden können.
Thomas Rießinger ist promovierter Mathematiker und war Professor für Mathematik und Informatik an der Fachhochschule Frankfurt am Main. Neben einigen Fachbüchern über Mathematik hat er auch Aufsätze zur Philosophie und Geschichte sowie ein Buch zur Unterhaltungsmathematik publiziert.
Bild: Yanosh Nemesh/ShutterstockBitte beachten Sie die aktualisierten Kommentar-Regeln – nachzulesen hier. Insbesondere bitte ich darum, sachlich und zum jeweiligen Thema zu schreiben, und die Kommentarfunktion nicht für Pöbeleien gegen die Kommentar-Regeln zu missbrauchen. Solche Kommentare müssen wir leider löschen – um die Kommentarfunktion für die 99,9 Prozent konstruktiven Kommentatoren offen zu halten.
Mehr von Thomas Rießinger auf reitschuster.de