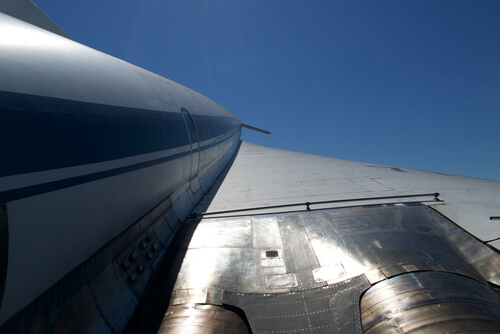Hand aufs Herz: Haben Sie es nicht auch satt, ständig negative Nachrichten zu lesen? Bei denen man denkt, es seien „Aufzeichnungen aus einem Irrenhaus“? Was sie aber leider nicht sind – denn es sind reale Neuigkeiten aus Deutschland. Ich möchte Ihnen ein Kontrastprogramm bieten, aus meiner Zeit in Russland. Zum Entspannen und Schmunzeln. Wobei zu dieser Geschichte gesagt werden muss, dass sich das Bild in der Zwischenzeit sehr gewandelt hat. Aus der einstigen Service-Wüste Moskau ist heute eine Service-Oase geworden – die Berlin blass dastehen lässt. Aber hier ein Blick zurück in die Zeiten vor knapp 20 Jahren, als das noch anders war. Voilà:
„Was? Ein Frühstück?“ Die Bedienung in der hautengen schwarzen Bluse schaut mürrisch an mir vorbei auf den Tisch: „Haben wir heute nicht.“ Irgendetwas anderes zum Essen? „Gibt es auch nicht.“ Die junge, hübsche Frau blickt mich so böse an, als ob ich ihr gerade ein unsittliches Angebot gemacht hätte: „Was wollen Sie überhaupt von mir? Der Koch ist heute früh nicht gekommen! Solange er nicht da ist, gibt es gar nichts.“ Wann er kommt? „In einer halben Stunde, gegen 11 Uhr. Vielleicht.“
Die Szene aus dem Restaurant „Monterosso“ am staubigen Moskauer Taganka-Platz ist alles andere als eine Ausnahme. Auch wenn sich die einst triste Sowjet-Metropole Moskau in eine glitzernde Boom-Stadt verwandelt hat: Wie der Rest des Landes ist auch die Hauptstadt eher Service-Notstandsgebiet als ein Paradies für Kunden.

Unter den Kommunisten hatten Verkäuferinnen, Bedienungen und Tankwarte als Verwalter des Mangels den Status von Fürsten: Sie entschieden, wem sie die begehrte Ware „abgaben“, wie das sowjetische Wort für „verkaufen“ hieß. Freundlichkeit war nur Sache der Kunden – wenn sie überhaupt Kunden werden wollten. Die alte Mentalität sitzt bis heute tief.
Solange man nicht in Kontakt mit der Bedienung kommt, könnte man sich das Restaurant Monterosso genauso gut in Berlin, Paris oder Rom vorstellen: Man sitzt in schicken Designermöbeln oder breite Sofas mit dicken Kissen vor den Fenstern, an den Wänden hängen Lifestyle-Fotos in Schwarz-Weiß und angesagte DJs sorgen für musikalische Untermalung.
Auch die Preise sind westlich: 400 Rubel, circa 13 Euro, kostet dort ein Hauptgericht. Im Vergleich zu anderen Moskauer Restaurants ist das fast umsonst – einerseits. Andererseits aber bei einem Durchschnittslohn von 500 Euro landesweit und 800 Euro in Moskau dennoch eine stolze Summe. Aber das ist für kaum jemand ein Hindernis, essen zu gehen. Wenn man Geld in der Tasche hat, legt man es in Russland nicht etwa auf die hohe Kante – man gibt es so schnell wie möglich aus. Das liegt nicht nur an der sprichwörtlichen Großzügigkeit der Russen, sondern auch an ihrer Lebenserfahrung: Im Sozialismus verlernten die Menschen, auf den Preis zu sehen. Es fehlte stets mehr an Waren als an Geld. Sobald es einmal etwas zu kaufen gab, langte man zu.
Der Rubel rollt
Zu Perestroika-Zeiten verwandelten Inflation, Geldreformen und Banken-Zusammenbrüche den Rubel mehrmals in wertloses Papier. Folglich war die Devise der Bevölkerung: Lieber heute ausgeben denn morgen als Altpapier entsorgen. Nur so ist zu erklären, warum die Packung Blauschimmelkäse in Moskau sechs Euro kostet, warum für eine Ein-Zimmer-Bruchbude 600 Euro Miete fällig sind und in Restaurants Weinflaschen für den gleichen Preis an den Mann gebracht werden. Zwar lebt immer noch ein Großteil der Russen am Rande des Existenzminimums. Doch zumindest in der Zehn-Millionen-Stadt Moskau ist die Zahl der Reformgewinnler groß genug, um den Rubel rollen zu lassen.
Doch so verwöhnt das zahlungskräftige Hauptstadt-Publikum inzwischen in Sachen Stil und Einrichtung ist – so wenig empört man sich über schlechten Service. Als die Uhr schon 11.15 zeigt, fehlt im Café Monterosso immer noch jede Spur vom Koch – und auch die Bedienung ist inzwischen verschwunden. Geduldig sitzen die Besucher an ihren Tischen – und harren aus. Gegen 11.30 taucht die Bedienung wieder auf, doch sie läuft schweigend an meinem Tisch vorbei.
„Gibt es immer noch nichts zu essen?“, frage ich sie. Offenbar nicht demütig genug. „Nein“, bescheidet sie mir kurz angebunden im Vorübergehen. „Und wann ist es soweit?“ Sie sieht mich an, als wolle ich sie selbst verspeisen. „Woher soll ich denn wissen, wann der Koch kommt. Wenn es Ihnen nicht passt, können Sie ja gehen!“ Gute Idee, denke ich. Was soll ich in einem Restaurant, in dem es nichts zu essen gibt?, und bewege mich zum Ausgang. Doch dann erwartet mich die nächste Überraschung: Der Garderobier ist augenscheinlich mit seiner Fortbildung beschäftigt, denn er löst gerade ein Kreuzworträtsel. Als er sieht, dass ich mit meiner Garderobenmarke vor den Kleiderhaken stehe, um meinen Mantel abzuholen, blickt er nur kurz verächtlich herüber und vertieft sich wieder in sein Heft. Das wäre ja auch noch schöner, wenn er wegen dieser lästigen Kunden aufstehen müsste. Ein typischer Fall von „unaufdringlichem Service“, wie die Russen den Totalausfall von Freundlichkeit ironisch nennen.
Doch in bin inzwischen abgehärtet und wühle mich selbst durch die Kleiderbügel – und kann es mir nur mit Mühe verkneifen, aus Rache die Garderobenmarke mitgehen zu lassen. Zumindest habe ich nun einen Verdacht, was die Besucher trotz des allzu „unaufdringlichen“ Personals in Wirklichkeit ins „Monterosso“ lockt: Es ist wohl der „falsche Spiegel“, zwischen Damen- und Herren-Toilettenraum, der von der Männerseite aus durchsichtig ist – und den Männern so einen geheimen Einblick in die verborgene Welt der Frauen erlaubt – ein „kleiner Gag des Besitzers“, wie einmal eine Bedienung – ausnahmsweise gut gelaunt – verriet.
Emanzipation als Schimpfwort
Was in westlichen Ländern den Wirt zumindest seine Lizenz kosten oder ihn vor den Kadi bringen würde, gilt russischen Männern fast als normal. Sexuelle Belästigung im weitesten Sinne wird hier als Auswuchs einer hysterischen Öffentlichkeit und frustrierter „Emanzen“ bagatellisiert. In der ehemaligen Sowjetunion ist Emanzipation noch ein Schimpfwort. Was man durchaus nachvollziehen kann, wenn man sieht, welche absurden Auswüchse diese eigentlich gute Sache inzwischen im Westen erreicht hat.
Der russische Durchschnittsmann erwartet von seiner Frau wie selbstverständlich, dass sie ihm morgens, mittags und abends das Essen auf den Tisch stellt. Und das ist, wie könnte es anders sein, nicht zuletzt eine Folge des schlechten Services der Restaurants: Man wird zwar auch außer Haus satt – aber selten mit einem Lächeln bedient.
Auch Alternativen zum Ausgehen wie eine Bestellung beim Pizzaservice funktionieren nur bedingt. Es kommt nämlich oft vor, dass die heiß begehrte Ware niemals ankommt. Wenn man nach zwei Stunden mit knurrendem Magen oder immer noch hungrigen und mittlerweile beleidigten Gästen nachfragt, wo das Abendessen geblieben sei, erklärt die Dame in der Leitung in aller Unschuld: „Oh, uns sind die Oliven ausgegangen. Deshalb haben wir Ihre Pizza Vegetarianskaja streichen müssen“. Zumindest Bescheid zu geben oder eine andere Pizza zu liefern, käme niemandem in den Sinn.
Dass der Kurier mit einer kalten Pizza daherkommt, weil er im Moskauer Stau feststeckt oder dass er ohne Wechselgeld ankommt, ist eher die Regel als die Ausnahme. Zuweilen bekommt man die falsche Pizza geliefert, was mir als Vegetarier nicht ganz egal sein kann. Umso dreister ist es, wenn der Schichtleiter sich weigert, sie umzutauschen und behauptet: „Sie können das doch gar nicht unterscheiden, ob da Fleisch drauf ist oder nicht.“
Auf der schwarzen Liste
Völlig baff war ich, als mir plötzlich bei einem der Pizzadienste die Dame am anderen Ende der Leitung eröffnete, ich sei auf der schwarzen Liste – und werde keine Pizza bekommen. Mein Vergehen lag darin, dass ich umgezogen war: Bei meiner letzten Bestellung via Internet hatte die Dame am anderen Ende der Leitung offenbar nicht genau hingesehen und statt meiner neuen Adresse einfach die alte aus ihrer Datenbank übernommen. Jedenfalls brachte der Kurier die Pizza an meine alte Adresse – und wurde sie dort natürlich nicht los. Weswegen ich offenbar auf eine Stufe gestellt wurde mir Übeltätern, die verhassten Lehrern oder Kollegen aus Jux Pizzas nach Hause ordern. Selbst gegen Vorkasse wollte das Unternehmen an mich nicht mehr liefern. Irina, meine Kollegin, musste ihre gesamte Überredungskunst an den Tag legen und einen halben Vormittag opfern, um mich vor dem Pizza-Knock-out zu retten.
Nicht ganz reibungslos funktioniert auch der Getränke-Lieferservice. Wenn der die falsche Limonade bringt, darf man nicht etwa auf eine Entschuldigung und den selbstverständlichen Austausch von Zucker gegen Light-Limo hoffen. Nach fünf Anrufen bei den verschiedensten Instanzen gibt es bei der „Beschwerde-Abteilung“ endlich eine Antwort: „Das ist Ihr Problem, nicht unseres.“ Erst die sehr laut artikulierten Worte „Generaldirektor“ und „Skandal“ sorgen für Bewegung: „An welcher Adresse sollen wir die Limonade umtauschen?“
Doch nicht nur bei Essen und Trinken herrscht der Service-GAU. Viele Devisen-Wechselstuben in Moskau erinnern heute noch an die Grenzübergänge zu Breschnews Zeiten – als die Gesichter der Grenzer hinter dunklem Spiegelglas allenfalls zu erahnen waren. Die Kassiererinnen verstecken sich hinter Jalousien, die so weit herunterhängen, dass man gerade noch die Hand mit dem Geld durchstrecken kann.
Nicht ganz geschmacksichere Kunden
Fehlender Durchblick ist auch anderweitig zu beklagen. Als ich kürzlich vor dem Spiegel stand und mich selbst nicht mehr wieder erkannte, lag das nicht etwa an einem akuten Anfall von Farbenblindheit oder einer plötzlichen Gewichtszunahme (woher auch, bei den Problemen mit Frühstücken und Pizzas) – sondern daran, dass meine Hose plötzlich lila glänzte und sich die Bundweite wundersam verdreifacht hatte. So bedurfte es keiner besonderen Beobachtungsgabe, um festzustellen, dass die Reinigung etwas verwechselt hat – und ich die Hosen eines farblich nicht ganz geschmacksicheren anderen Kunden bekommen habe. Der Form nach zu urteilen einer russischen Cover-Version von Ex-Fußball-Funktionär Reiner Calmund.
Ich eilte zur Reinigung, um die Verwechslung mitzuteilen. Aber die Mitarbeiterin nahm weder meine Meldung dankbar zu Kenntnis noch entschuldigte sie sich für den Fauxpas. Wie einem ertappten Dieb riss sie mir die Hosen aus der Hand und schrie: „Ah, die suchen wir schon. Sie haben die also, na endlich sind sie zurück“, und entschwand.
Als sie nach einer halben Ewigkeit zurückkam und ich sie höflich darauf aufmerksam machte, dass nun auch mir zwei Hosen fehlen, blickte sie mich unwirsch an: „Schreiben Sie einen Brief an den Direktor“. Den Brief habe ich geschrieben; auf die Hosen oder zumindest eine Entschädigung warte ich seit mehr als einem Jahr , und nur dem Trend zur Zweithose habe ich es zu verdanken, dass ich nicht mit einer Wolldecke um die Hüften geschlungen durch den Alltag stolpern muss.
Warten auf die Chefin
Manchmal ist es denn auch besser, ganz auf eine Beschwerde zu verzichten. Zumindest in der Metro. Als die Drehkreuze am Eingang plötzlich meine Monatskarte nicht mehr akzeptieren – der Magnetstreifen hatte wohl das Zeitliche gesegnet – stelle ich mich brav in die Warteschlange an der Kasse. Als ich nach zehn Minuten endlich dran bin, mache ich in meiner westlichen Unbedarftheit einen unverzeihlichen Fehler: Ich zeige die alte, kaputte Karte vor und bitte die betagte Dame hinter der Plexiglas-Scheibe, die ihre Hornbrille notdürftig mit Tesafilm zusammengeklebt und in die Frisur gesteckt hat, sie auszutauschen. „Da müssen Sie warten, das kann nur unsere Schichtleiterin machen, aber die ist gerade essen.“ Meinen genervten Blick quittiert sie ganz charmant: „Es kann aber höchstens zwanzig Minuten dauern.“
„Okay, dann kläre ich das mit der Monatskarte ein anderes Mal, verkaufen Sie mir jetzt bitte einen Einzelfahrschein“, bitte ich die Kassiererin. „Das geht nicht, wir müssen das jetzt klären mit Ihrer Monatskarte, solange kann ich Ihnen keinen Einzelfahrschein verkaufen.“ Dabei muss ich dringend zu einem Treffen. Das ist meine Rettung: Denn der miserable Service in Russland wird oft durch herzerweichende Menschlichkeit kompensiert – wenn man es nur richtig angeht. „Bitte, bitte, sind Sie so lieb – ich muss zu einem wichtigen Termin“, säusle ich Richtung Glasfenster. Plötzlich verwandelt sich die faltige Dame mit dem strengen Gesicht in eine lächelnde alte Babuschka: „Na gut, hier bitte, mein Söhnchen!“
Für meine Arbeit müssen Sie keine Zwangsgebühren zahlen, und auch nicht mit Ihren Steuergeldern aufkommen, etwa über Regierungs-Reklameanzeigen. Hinter meiner Seite steht auch kein spendabler Milliardär. Mein einziger „Arbeitgeber“ sind Sie, meine lieben Leserinnen und Leser. Dadurch bin ich nur Ihnen verpflichtet! Und bin Ihnen außerordentlich dankbar für Ihre Unterstützung! Nur sie macht meine Arbeit möglich!
Aktuell ist (wieder) eine Unterstützung via Kreditkarte, Apple Pay etc. möglich – trotz der Paypal-Sperre: über diesen Link. Alternativ via Banküberweisung, IBAN: DE30 6805 1207 0000 3701 71. Diejenigen, die selbst wenig haben, bitte ich ausdrücklich darum, das Wenige zu behalten. Umso mehr freut mich Unterstützung von allen, denen sie nicht weh tut.
Mein aktuelles Video:

 Bild: Shutterstock
Bild: ShutterstockLust auf mehr Geschichte über Igor und aus Russland? Die gibt es auch als Buch:
Und hier noch mehr: