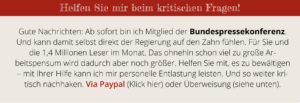Ein Gastbeitrag von Vera Lengsfeld
Die Gedenkstätte in der ehemaligen Zentralen Untersuchungshaftanstalt der Staatssicherheit in Berlin-Hohenschönhausen ist ein erfolgreiches Projekt der ehemaligen politischen Gefangenen der DDR. Das Gefängnis war auf keinem Stadtplan verzeichnet. Es blieb den Augen der Öffentlichkeit weitgehend verborgen, weil es von einem eingezäunten Sperrgebiet umgeben war. Die Straßen, die zum Gefängnis führten, waren mit eisernen Rolltoren versperrt. Große Schilder wiesen darauf hin, dass Fotografieren verboten sei. Ein zufälliger Fußgänger, der aus der Ferne bei geöffnetem Rolltor einen Blick auf ein weiteres eisernes Tor und stacheldrahtbewehrte Mauern werfen konnte, wußte nicht, was er sah. Es hätte sich um eine Einrichtung der Polizei, der Volksarmee oder der Westgruppe der Sowjetischen Streitkräfte handeln können.
Auch die Gefangenen, die hier landeten, wußten nicht, wo sie sich befanden. Sie kamen gefesselt in Dunkelzellen der Transporter an und verließen sie erst in der sogenannten Schleuse, eine Art Garage, die mit einem weiteren Rolltor verschlossen wurde. Ich habe ehemalige Mitgefangene getroffen, die tatsächlich erst nach der Vereinigung aus ihren Akten erfahren haben, dass sie in Hohenschönhausen gewesen sind.
Es handelte sich um eine perfekte Isolationshaft. Das ganze Regime war so organisiert, dass die Gefangenen einander nie sahen, außer die Stasi wollte es. Wenn man nach Tagen endlich einen Zellengefährten bekam, handelte es sich oft um einen Zellenspitzel. Das waren entweder Gefangene, die mit der Staatssicherheit kooperierten, um Strafmilderung zu erlangen, oder, wie in meinem Fall, verkleidete Stasileute, die trainiert waren, Informationen zu bekommen. Die Untersuchungshaft konnte sich wochen- oder monatelang hinziehen. Es gab weder Radio noch Fernsehen, keinen Kontakt zur Außenwelt, Bücher nur, wenn man auf die Idee kam, welche zu verlangen. Durch die Glasbausteine der Fensteröffnungen kam etwas Licht in die Zelle, von der Umgebung sah man nichts, auch nicht beim Freigang, der in einer Freiluftzelle absolviert werden musste, die doppelt mannshohe Mauern hatte und von einem eisernen Steg überquert wurde, auf dem bewaffnete Posten patrouillierten.
Während der Friedlichen Revolution wurden die Stasizentralen gestürmt und aufgelöst, die Gefängnisse aber vergessen.
Erst nach der freien Volkskammerwahl erinnerte ich mich als Abgeordnete daran, dass mir nun Zugang zu den Gefängnissen gewährt werden musste. Ich verlangte im April 1990, das Gefängnis zu besichtigen. Es war ein Erlebnis der dritten Art, denn die Wärter, die mich noch als Gefangene durch die Gänge gescheucht hatten, mussten mir jetzt alles zeigen.
Ich staunte über die einfache dreiflüglige Konstruktion des Gebäudes. Als Gefangene war ich nie direkt von A nach B geführt worden, sondern treppauf, treppab, um viele Ecken, so dass ich die Orientierung verlor und das Gefühl bekam, mich in einer Art Labyrinth zu befinden.
Die Zellen sahen ganz anders aus, als ich sie erlebt hatte. Wir hatten nur eine Holzpritsche mit erhöhtem Kopfteil, das zur Tür zeigte, über der in regelmäßigen Abständen über Nacht immer wieder eine grelle Lampe aufleuchtete. Die einzig erlaubte Schlafposition war, auf dem Rücken, mit den Händen sichtbar auf der Decke zu liegen. Es gab noch ein Holztischchen, einen Hocker, einen kleinen Wandschrank für die Waschutensilien: Seife, Zahnpasta, Zahnbürste, Zahnputzbecher, Handtuch. Das war alles.
Jetzt sah ich richtige Metallbetten, Schränke für die persönlichen Sachen der Gefangenen, Radios, Fernseher, Plattenspieler, Bücher, Zeitschriften, Kartenspiele. Auch die Freiluftzellen existierten nicht mehr. Stattdessen gab es einen Freigangshof mit Bänken und Blumenkübeln. Die Dunkelarrestzellen waren mit Gerümpel vollgestopft, so dass man nichts erkennen konnte. Das stellte sich später als Glück heraus, denn die Stasi vergaß, die Wandverkleidung zu demontieren, so dass die Zellen im Originalzustand erhalten blieben.

An den Veränderungen wurde deutlich, dass die Stasi bemüht war, ihre Spuren zu verwischen und ihre Haftanstalt wie ein gewöhnliches Gefängnis aussehen zu lassen.
Erst am Tag nach der Vereinigung wurde das Gefängnis geschlossen. Dann stand es einige Jahre leer. Zum Glück gab es die Antistalinistische Aktion Berlin-Normannenstraße e.V., die im Sommer 1990 von Mitgliedern des Bürgerkomitees und Bürgerrechtlern, die an der Auflösung der Stasizentrale beteiligt waren, gegründet wurde. Die ASTAK e.V. hatte es sich zur Aufgabe gemacht, mit dem Aufbau der Forschungs- und Gedenkstätte Normannenstraße (später in Stasimuseum umbenannt) zu beginnen. Da sich im vereinten Deutschland keine staatliche Institution zuständig fühlte, übernahm die ASTAK e.V. auch die Trägerschaft des Museums.
Schon 1991 kam die Idee auf, auch die ehemalige Stasihaftanstalt einzubeziehen. Jörg Drieselmann, der Chef der ASTAG, vereinbarte mit der Verwaltung in Hohenschönhausen, dass er Schlüssel zu der Anlage bekam, um dort Führungen von ehemaligen politischen Gefangenen abhalten zu können. Diese Führungen wurden schnell ein beeindruckender Erfolg. Besonderen Anteil daran hatten Gerhard „Charly“ Rau, der 17 Jahre inhaftiert gewesen war, und der Psychologe und Hochschullehrer Hans-Eberhard Zahn, der schon in den 50er Jahren in die Fänge der Stasi geriet und 7 Jahre im Zuchthaus saß. Charly machte sich gemeinsam mit einem anderen politischen Gefangenen, der aber nicht genannt werden will, auf die Suche nach dem Originalmobiliar. Sie fanden im Schuppen eines Heizhauses noch Holzpritschen, Tischchen und Hocker und brachten sie zurück ins Gefängnis, wo einige Zellen wieder original ausgestattet werden konnten.
Ein erster Erfolg war, dass die Haftanstalt 1992 unter Denkmalschutz gestellt wurde. Damit war den Plänen, sie in ein Gewerbegebiet umzuwandeln, ein Riegel vorgeschoben, obwohl diese noch jahrelang weiter verfolgt wurden. So soll es Versuche des Kultursenators Thomas Flierl (SED-PDS) gegeben haben, das Hauptgebäude für baufällig zu erklären, die jedoch erfolgreich abgewendet werden konnten. Gleichzeitig gab es eine regelrechte Kampagne der ehemaligen Stasimitarbeiter gegen die Gedenkstätte.
Schon 1994 waren die Führungen so erfolgreich, dass das Projekt in eine Gedenkstätte umgewandelt wurde. Seit dem Jahr 2000 ist sie eine Berliner Stiftung öffentlichen Rechts. Im Dezember 2000 wurde der Historiker Hubertus Knabe der Direktor, sein Stellvertreter war bis 2009 Siegfried Reiprich, der von Helmuth Frauendorfer abgelöst wurde, weil Reiprich die Leitung der Sächsischen Gedenkstätten übernahm.
In der Ära Knabe erlangte die Gedenkstätte internationale Bedeutung. Sie ist Mitglied der Platform of European Memory and Conscience.
Wie effektiv ihre im Gesetz über die Errichtung der Stiftung „Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen“ festgelegte Aufgabe erledigt wurde, war immer ein Dorn im Auge der umbenannten SED. In allen Jahren ihrer Existenz musste sich besonders Knabe immer wieder Angriffen erwehren. Die Gedenkstätte wurde zur Forschungsanstalt, nicht nur, was die Geschichte der Haftanstalt Hohenschönhausen in den Jahren 1945 bis 1989 betrifft, sondern durch Ausstellungen, Veranstaltungen, Publikationen und Seminare informierte sie über die Auseinandersetzung mit den Formen und Folgen politischer Verfolgung und Unterdrückung in der kommunistischen Diktatur, insbesondere ihrer politischen Justiz.
In Knabes Amtszeit stiegen die Besucherzahlen von rund 50.000 auf über 450.000 pro Jahr. Besonders nach dem Film „Das Leben der Anderen“ kamen verstärkt Schulklassen. Das Gros der Besucher sind mittlerweile Schüler, die vor allem aus den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg kommen. Ausländische Gruppen kommen vor allem aus Dänemark, Norwegen und Großbritannien.
Einen besonderen Anteil am Erfolg der Gedenkstätte hatten die Besucherreferenten, die anfangs mehrheitlich aus ehemaligen politischen Gefangenen bestanden, die neben anderen Informationen auch ihre persönliche Geschichte einbringen konnten. Das machte größeren Eindruck als alle trocken vermittelten historischen Fakten.
Außer Führungen gibt es auch Lehrangebote an Schulen. Dafür wurde in Zusammenarbeit mit dem Berliner Landesinstitut für Schule und Medien Unterrichtsmaterial entwickelt. Bei einem von der Gedenkstätte angebotenen Projekttag werden den Schülern die Haftbedingungen aus der Sicht der Inhaftierten veranschaulicht.
Das alles war den ehemaligen Betreibern höchst unangenehm. Am 14. März 2006 kam es zum Eklat. Hochrangige ehemalige Stasi-Offiziere und -Funktionsträger wie Wolfgang Schwanitz und der frühere Anstaltsleiter Siegfried Rataizick bestritten während einer Podiumsdiskussion die Misshandlungen an Häftlingen, behaupteten, die Schilderungen über die Zustände in der Haftanstalt seien unzutreffend und leugneten den von der Stasi ausgeübten Terror gegen politische Gegner.
Dieser Vorstoß wurde mit Hilfe des Berliner Abgeordnetenhauses zurückgewiesen. Besonders der damalige Präsident des Abgeordnetenhauses Walter Momper versicherte den Opferverbänden und der Gedenkstätte die Unterstützung des Abgeordnetenhauses und griff die ehemaligen Stasi-Offiziere scharf an.

Danach kam es mehrfach zu Versuchen ehemaliger Stasi-Offiziere und -Mitarbeiter, die sich zum Teil fälschlich als sächsische Historiker ausgaben, die Führungen durch Zwischenrufe zu stören. Diese Bemühungen wurden eingestellt, nachdem sie bei den Besuchern auf wenig Resonanz oder gar offene Ablehnung stießen.
Der entscheidende Angriff auf die Gedenkstätte erfolgte 2018, als Vorwürfe gegen den stellvertretenden Direktor öffentlich wurden. Ihm wurde vorgeworfen, weibliche Angestellte und Praktikantinnen sexuell belästigt zu haben. Ich will an dieser Stelle nicht die Bewertung dieser Vorwürfe diskutieren, noch wage ich eine Beurteilung, ob Knabe als Vorgesetzter alle nötigen Maßnahmen ergriffen hat, um mit der Situation richtig umzugehen.
Als Skandal empfinde ich, dass Senator Lederer (SED-Linke) Knabe vor seinem Erscheinen beim Untersuchungsausschuss im Abgeordnetenhaus einen juristischen Maulkorb verpasst hat, der geeignet ist, die Aufklärung zu verhindern. Klar wird auch, dass mit der umstrittenen Ablösung von Knabe als Direktor eine tiefgreifende Veränderung in der Gedenkstätten-Konzeption verbunden wird. Die Zeitzeugen, die jahrelang selbstständig Gruppen geführt haben, sollen nun Führungen in Begleitung, „Tandemführungen“ machen. Das sieht stark nach Zensur aus, auch wenn es nicht so genannt wird.
Die Zeitzeugen kaltzustellen, bedeutet, den Erfolg der Gedenkstätte zu schmälern. Genau das liegt im Interesse der umbenannten SED, die die Aufklärung ihrer Verbrechen an politischen Gefangenen fürchtet wie der Teufel das Weihwasser. Es geht also nicht nur um Knabe, es geht um die Gedenkstätte als Vermächtnis der politisch Inhaftierten.

Vera Lengsfeld, geboren 1952 in Thüringen, ist eine Politikerin und Publizistin. Sie war Bürgerrechtlerin und Mitglied der ersten frei gewählten Volkskammer der DDR. Von 1990 bis 2005 war sie Mitglied des Deutschen Bundestages, zunächst bis 1996 für Bündnis 90/Die Grünen, ab 1996 für die CDU. Seitdem betätigt sie sich als freischaffende Autorin. 2008 wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt. Dieser Beitrag erschien zuerst auf Vera Lengsfelds Blog, den ich sehr empfehle. Sie finden ihn hier.
Bild: kristof lauwers/Shutterstock
Text: gast