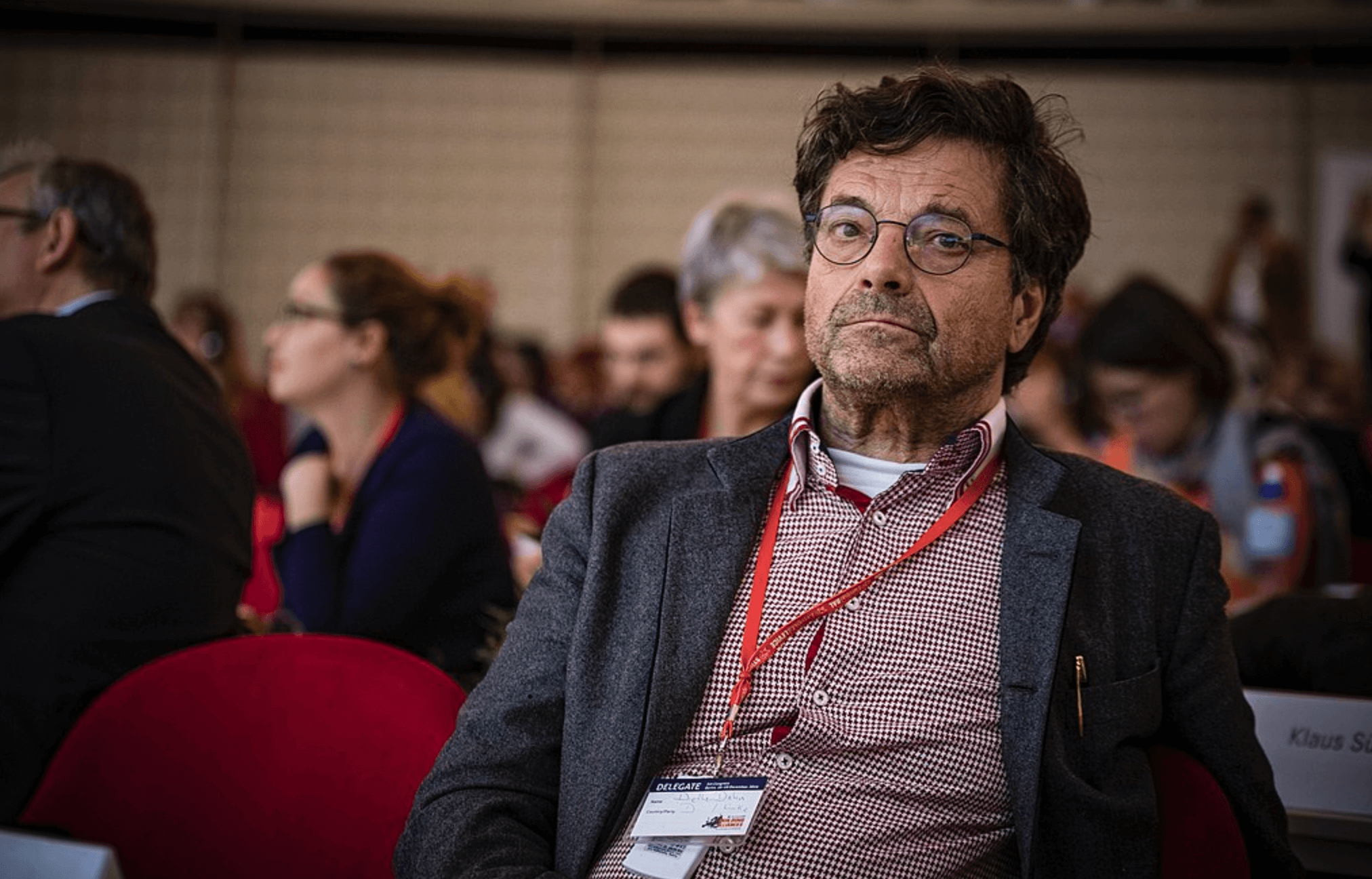Von Kai Rebmann
Es ist noch gar nicht so lange her, da war der Vorwurf des Rassismus ein durchaus schwerwiegender. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Dabei entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, dass dafür ausgerechnet jene verantwortlich sind, die sich den angeblichen Kampf gegen eben diesen Rassismus immer so groß auf ihre Fahnen schreiben. Wir leben in einer Welt, in der sich schon ein kleiner Bub, der als Indianer verkleidet zum Kinder-Fasching geht, der kulturellen Aneignung verdächtig macht. Schwarze, die Lederhosen und Tirolerhüte tragen, sind hingegen völlig unproblematisch. Wir leben in einer Zeit, in der jeder als rechts gilt, der nicht ultralinks ist. Der Definition der kunterbunten Blase folgend, ist der Rassismus in den 2020er-Jahren zu etwas geworden, das dem „Weißsein“ quasi durch Geburt inhärent zu sein scheint. Man wird nicht mehr zum Rassisten, sondern kommt schon als solcher auf die Welt.
Das jüngste Beispiel für die immer weiter fortschreitende Verwässerung des Rassismus-Begriffs lieferte jetzt Tressie McMillan Cottum. Die US-Soziologin ist schwarz vom Scheitel bis zur Sohle und wirft insbesondere Frauen vor, mit dem Blondieren ihrer Haare dem einen Ideal des hellen bzw. blonden Phänotyps entsprechen zu wollen. Herausgefunden haben will die Professorin der University of North Carolina das während einer mehrwöchigen Auszeit infolge einer „Lungenentzündung“, wie sie in einem Kommentar in der „New York Times“ schreibt. Das intensive Studium von Videos und Kommentaren auf TikTok rund um das „Blondsein“ führte die Forscherin schnell zu der wichtigen Erkenntnis: Die weiße Mehrheitsgesellschaft verwende Wörter wie „blond“ – und in geringerem Maße auch „brünett“ –, um damit „rassistische Begriffe wie weiß“ zu vermeiden, so der Vorwurf der Soziologin.

Shitstorm von ‚selbsternannten Blondinen‘
Als Beispiel für diese These führt McMillan Cottom das Video einer Nutzerin an, die sich zwar die Haare blondiert hat, durch „dunkelbraune Ansätze“ aber Auskunft über ihren wahren Phänotypus gibt. Klarer Fall von kultureller Aneignung, der ein zutiefst rassistisches Gedankengut innewohnt, so zumindest die Meinung der Professorin. Die Wasserstoff-Blondine sah sich in den Kommentaren bereits von anderen Nutzern mit dem „Vorwurf“ konfrontiert, sich die Haare zu färben, obwohl sie doch offensichtlich eine „Brünette“ sei. Nein, sie sei eine echte Blondine, da ihre Mutter auf entsprechende Nachfrage bestätigt habe, dass sie als Kind blond gewesen sei, schrieb die so Beschuldigte zu ihrer Verteidigung.
Sodann warf McMillan Cottum die aus ihrer Sicht weltbewegende Frage auf, was an diesem genetischen Merkmal so wichtig sein könnte, „dass jemand es verwendet, um sich selbst zu beschreiben, lange nachdem der phänotypische Ausdruck dieses Merkmals – helles Haar – nicht mehr existiert?“ Das mache nur Sinn, wenn sich „blond“ auf mehr als nur Haare beziehe. „Eine natürliche Blondine zu sein, muss denen Ehre, Wertschätzung und Macht verleihen, die sie berechtigterweise beanspruchen können“, fasst die Forscherin ihre Erkenntnisse über das Verhalten der blonden Brünetten zusammen.
Ganz ähnliche Erfahrungen will die Professorin schon vor zehn Jahren gemacht haben. Im Jahr 2013 hat sie eigenen Angaben zufolge ihre erste wissenschaftliche Arbeit veröffentlicht, einen Essay über einen Auftritt von Miley Cyrus bei einer Preisverleihung, den McMillan Cottom als „sexuell provokative Nummer mit schwarzen Tänzerinnen“ bezeichnete. Damals habe sie einen mehrere Tage anhaltenden Shitstorm von „selbsternannten Blondinen“ geerntet. Ein anderer „beliebter TikTok-Account“ soll seine Follower dazu angestachelt haben, so die Vermutung der Soziologin. Schon damals hätten diese Leute ihre Idee vom „Blondsein als sozialem Status“ nicht verstanden, wie McMillan Cottom einmal mehr ernüchtert feststellen musste.
Blonde Spanier und schwarze Skandinavier?
Es scheint auf TikTok aber doch noch ein paar Nutzer zu geben, die in der Lage sind, sich in die Gedankenwelt der Soziologie-Professorin hineinzuversetzen – oder dies zumindest vorgeben. Den Ehrgeiz, blond sein zu wollen und die Enttäuschung darüber, bei dieser „genetischen Lotterie“ das falsche Los gezogen zu haben, beschreibt McMillan Cottom als globales Problem. Aus der ganzen Welt – von Brasilien über Spanien, Italien und Schweden bis nach Südkorea – erreichten sie Zuschriften von Menschen, die ihr berichteten, wie sehr sie in ihrem Leben darunter zu leiden hätten, „nicht blond zu sein.“
Das klingt zunächst erstaunlich. Denn ebenso wie der „dunkle Phänotypus“ in den meisten Regionen Skandinaviens eine Ausnahmeerscheinung ist, so selten sind in Spanien oder Italien blonde Südländer anzutreffen. Dass einem Tanzlehrer in Oviedo oder einem Pizzabäcker in Neapel ein Nachteil daraus erwachsen soll, weil er „nicht blond“ ist, erscheint schwer vorstellbar. Deshalb untermauert McMillan Cottom ihre These mit wahrlich erschütternden Lebensbeichten ihrer Leser aus Südamerika, Europa und Fernost. Von Großeltern, denen es das Herz gebrochen habe, als die blonden Haare ihres Enkels mit zunehmendem Alter immer dunkler geworden sind. Oder der Frau, die in einem Akt der Verzweiflung zum Wasserstoff gegriffen hat, um mit den blonden Haaren einen Gegenpol zu ihrer Fettleibigkeit zu setzen. Und natürlich von dem Schicksal einer dunkelhaarigen Jüdin, der bei der „genetischen Lotterie“ die aus Sicht der Soziologin wohl größtmögliche aller Nieten angedreht worden war.
Diese absurde Debatte zeigt einmal mehr, dass heutzutage nicht einmal mehr Modeerscheinungen – seien es Dreadlocks, Irokesenschnitte oder eben blonde Haare – vor einer ideologischen Vereinnahmung sicher sind. Weiße mit Rastalocken oder Schwarze mit wasserstoffblonden Haaren werden mit Sicherheit nicht jeden Geschmack treffen, schon allein aus stilistischen Gründen. Aber daraus den Vorwurf der kulturellen Aneignung und des strukturellen Rassismus zu konstruieren, der jeweils aber nur als Einbahnstraße zu verstehen ist, ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wohl sich einige Menschen in der von ihnen selbst zugedachten Opferrolle fühlen.
Wollen Sie auch weiterhin Artikel wie diesen lesen? Dann kommt es auf Ihre (Mit-)Hilfe an!
Aktuell ist (wieder) eine Unterstützung via Kreditkarte, Apple Pay etc. möglich – trotz der Paypal-Sperre: über diesen Link. Alternativ via Banküberweisung, IBAN: DE30 6805 1207 0000 3701 71. Diejenigen, die selbst wenig haben, bitte ich ausdrücklich darum, das Wenige zu behalten. Umso mehr freut mich Unterstützung von allen, denen sie nicht weh tut.
Mein aktuelles Video:

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben immer die Meinung des Autors wieder, nicht meine. Ich schätze meine Leser als erwachsene Menschen und will ihnen unterschiedliche Blickwinkel bieten, damit sie sich selbst eine Meinung bilden können.
Kai Rebmann ist Publizist und Verleger. Er leitet einen Verlag und betreibt einen eigenen Blog. Bild: ShutterstockMehr von Kai Rebmann auf reitschuster.de