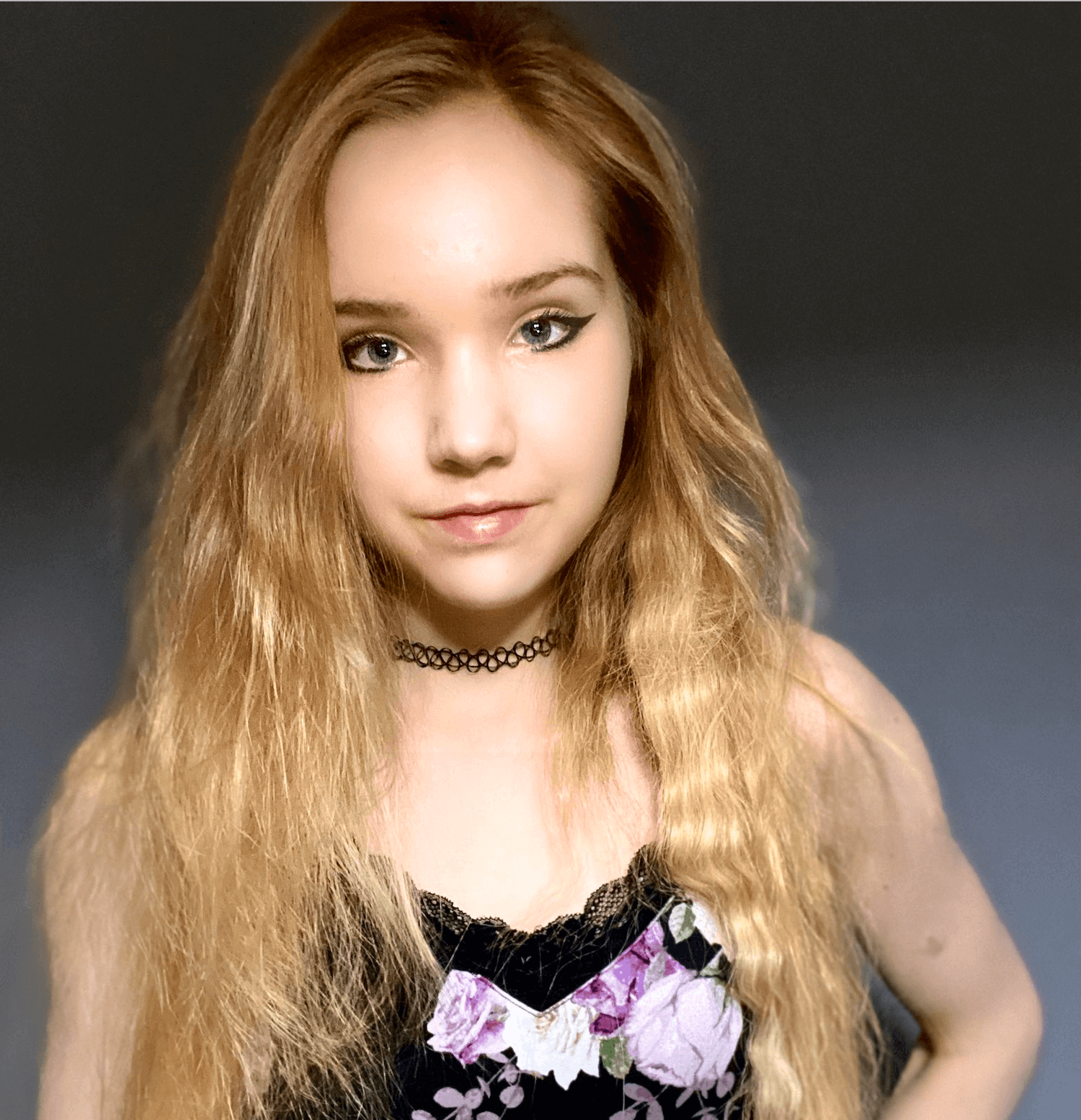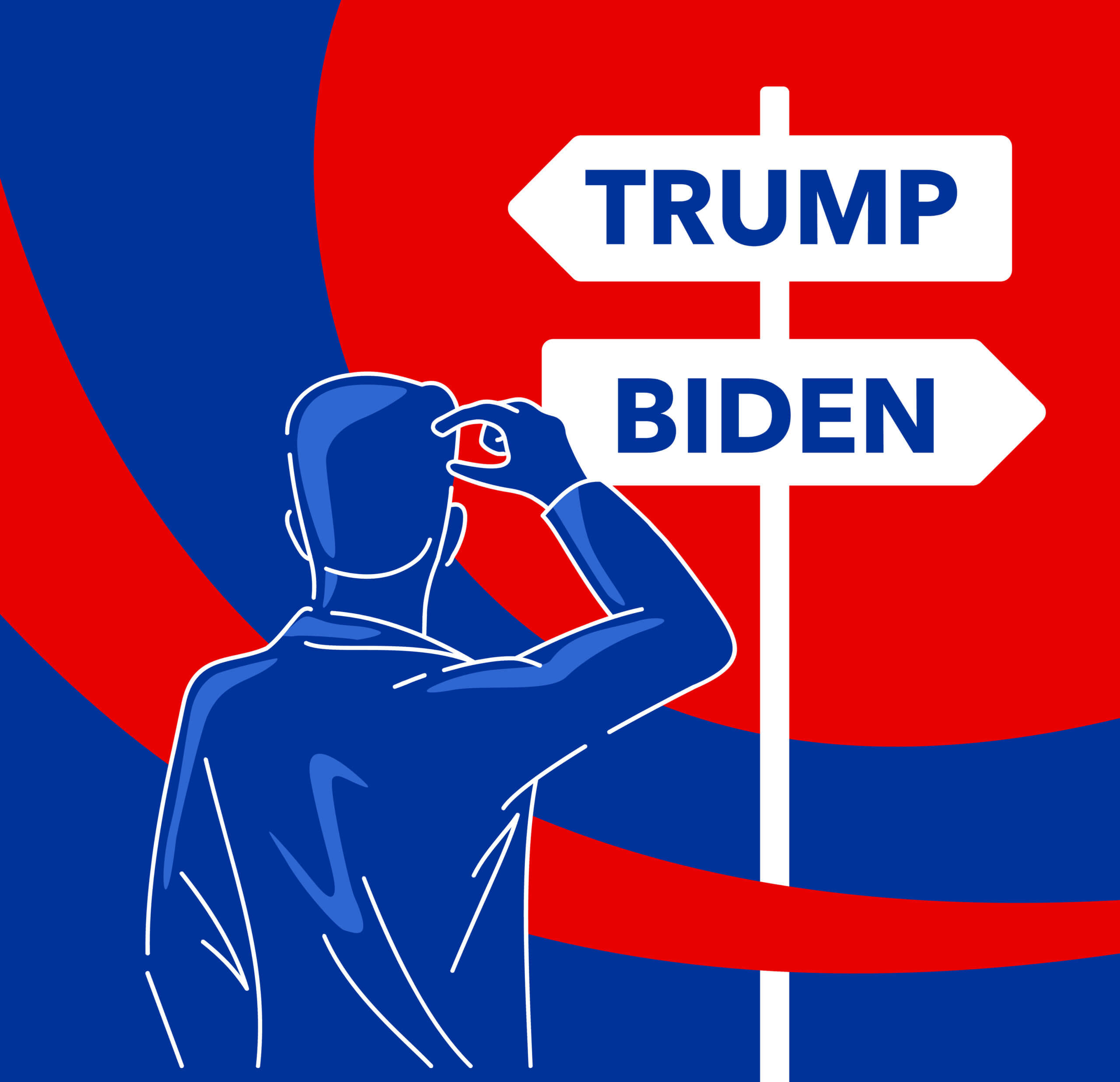Ein Gastbeitrag von Prof. Felix Dirsch
Eineinhalb Jahrhunderte nach seiner Gründung ist uns das Deutsche Kaiserreich von 1871 weithin ferngerückt. Ganz aus aktuellen Debatten ist dieses Gebilde aber nicht verschwunden. Die Rede Frank-Walter Steinmeiers zum letztjährigen Tag der Deutschen Einheit verwendete das „Bismarck-Reich“ als Negativfolie im Kontrast zum vereinigten Deutschland von 1990. Er erwähnte als einen fundamentalen Unterschied zu „1871“ das Fehlen von „Reichsfeinden“, die man vor drei Jahrzehnten vergeblich sucht. Vergessen hat er selbstredend, dass auch die gegenwärtige Gesellschaft vor dem (weitgehend selbstgemachten) Problem einer immer größeren Fragmentierung mit kaum zu bewältigenden Herausforderungen der Integration steht.
Vor wenigen Tagen hat der Bundespräsident zum aktuellen Gedenken ein weiteres Mal versucht, Heinrich von Treitschkes Diktum zu befolgen, sich um „Vergegenwärtigung der Vergangenheit zum Zweck der Orientierung für Gegenwart und Zukunft“ zu bemühen. Er erwähnte am Ende der Ansprache neonationalistische Tendenzen, den „Sturm“ auf den Reichstag vor einigen Monaten und die Ereignisse auf dem Washingtoner Kapitol. Deutlicher hätte das Staatsoberhaupt kaum ausdrücken können, welche volkspädagogischen Hintergründe für ihn eine wichtige Rolle spielen in der Auseinandersetzung mit einem Stück ungeliebter Vergangenheit.
Was in der neueren Literatur als „Mythos von der deutschen Einheit“ (Tillmann Bendikowski) negativ-kritisch thematisiert wird, verdient eine ausführlichere Betrachtung. Jedes historische Handeln unterliegt der Kontingenz. Das bedeutet, dass die zugrundeliegenden Faktoren auch zu etwas anderem hätten führen können. Von den Gegnern der Reichseinigung wird bis heute gern ins Feld geführt, dass sich die Nationswerdung auch nach der Blaupause des Verfassungsentwurfs der Frankfurter Paulskirche-Versammlung von 1848/49 hätte abspielen können, besser: sollen. Solche Gedankenspiele sind legitim. Sie möchten mittels eines fiktiven Alternativszenarios in erster Linie einen zentralen Makel der Genese des Kaiserreiches beseitigen: dass an seiner Entstehung fast ausschließlich Militärs, Fürsten und der preußische König (und spätere Kaiser Wilhelm I.) beteiligt waren. Immerhin siegte ein Volksheer gegen die Franzosen und schuf wesentliche Voraussetzungen für die Weichenstellung. Außerdem irritiert eine verteidigungsunfähige gegenwärtige Zivilgesellschaft die Blut-und-Eisen-Politik Bismarcks, näherhin die drei Kriege als unabdingbare Voraussetzung des Akts der Proklamation am 18.01.1871 in Versailles. Das Volk zu befragen galt als unnötig. Von einer verfassungsrechtlichen Einzigartigkeit kann man in diesem Fall jedoch nicht sprechen, wenn man die Umstände der Entstehung des Grundgesetzes fast acht Jahrzehnte später bedenkt.
 Es bedarf kaum historischer Kenntnisse, wenn man gegen solche kontrafaktischen Entwürfe einen naheliegenden Widerspruch vorbringt: Opposition gegen die Unifizierung kam nicht nur von etlichen Mitgliedern des Deutschen Bundes, unter anderem Bayern, die um Einschränkung ihrer Rechte und die Übermacht Preußens fürchteten; darüber hinaus leisteten die Nachbarstaaten, vornehmlich Frankreich, schon im Vorfeld der Einigung Widerstand. In einem Zeitalter, in dem nationalistische Tendenzen vorherrschten, war Bismarcks Werk nicht ohne militärische Mittel zu verwirklichen. Die Territorien des Deutschen Bundes waren allein zu schwach, um sich gegen die Nationalstaaten der Umgebung durchzusetzen. Gewisse Parallelen dazu finden sich in der heutigen globalen Welt, in der es ebenfalls – so wird jedenfalls oft behauptet – einer forcierten Einigung Europas bedürfe, um mit mächtigen Wirtschaftsblöcken in der Welt konkurrieren zu können.
Es bedarf kaum historischer Kenntnisse, wenn man gegen solche kontrafaktischen Entwürfe einen naheliegenden Widerspruch vorbringt: Opposition gegen die Unifizierung kam nicht nur von etlichen Mitgliedern des Deutschen Bundes, unter anderem Bayern, die um Einschränkung ihrer Rechte und die Übermacht Preußens fürchteten; darüber hinaus leisteten die Nachbarstaaten, vornehmlich Frankreich, schon im Vorfeld der Einigung Widerstand. In einem Zeitalter, in dem nationalistische Tendenzen vorherrschten, war Bismarcks Werk nicht ohne militärische Mittel zu verwirklichen. Die Territorien des Deutschen Bundes waren allein zu schwach, um sich gegen die Nationalstaaten der Umgebung durchzusetzen. Gewisse Parallelen dazu finden sich in der heutigen globalen Welt, in der es ebenfalls – so wird jedenfalls oft behauptet – einer forcierten Einigung Europas bedürfe, um mit mächtigen Wirtschaftsblöcken in der Welt konkurrieren zu können.
Die vielfältige deutsche Nationalbewegung seit den Befreiungskämpfen gegen Napoleon förderte den Einigungswillen über Jahrzehnte. Studenten, Turner und Sänger leisteten beträchtliche ideelle Vorarbeiten. Besonders Liberale taten sich hervor. Protestantische Legitimisten wie die Gebrüder von Gerlach wendeten sich hingegen von dem protegierten Bismarck ab, der sich bald als „weißer Revolutionär“ (Lothar Gall) entpuppte. Er setzte von „oben“ durch, was von „unten“ nicht erwünscht war.
Die Integration unterschiedlicher Regionen, insbesondere aus dem südlichen und mittleren Teil Deutschlands, aber auch die Eingliederung verschiedener Bevölkerungsgruppen erwies sich als herkulische Aufgabe. Die neue Führungsschicht und ihre Anhänger stigmatisierten etliche Gruppen als „Reichsfeinde“. Im Kulturkampf der 1870er Jahre wurden massiv Rechte der katholischen Kirche beschnitten. Noch schärfer verfolgte der neue Staat die sozialistische Minderheit, die im Laufe der Jahrzehnte dennoch an Größe zunahm. Auch Juden mussten etliche Ressentiments erdulden. Nichtsdestotrotz schützte die Reichsverfassung die Religionsgemeinschaften. Liberale spalteten sich in solche, die das Einigungswerk begrüßten, und in solche, die sich diesem verweigerten. Gleiches gilt für Konservative. Die polnische Minderheit im Osten war Maßnahmen zur „Germanisierung“ ausgesetzt. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg drohte der weltanschauliche Bürgerkrieg in einen offenen überzugehen. Der „Burgfrieden“ von 1914 überdeckte die Konflikte nur kurzzeitig.
Nun fallen aus heutiger Sicht diverse institutionelle Mängel auf: Das geheime und allgemeine Männerwahlreich auf Reichsebene galt damals in Europa als Fortschritt – ganz im Gegensatz zum preußischen Dreiklassenwahlrecht, das bis 1918 in Kraft blieb. Dennoch ist der nur unzureichend ausgeprägte Grundrechtsschutz bemerkenswert, den die Versammlung in der Paulskirche einst betont hatte. Das Reich war föderal organisiert, aber mit Dominanz Preußens, besonders im Bundesrat. Es waren ja die Fürsten, die einen „ewigen Bund“ geschlossen hatten. Die Möglichkeiten des Reichstages waren eingeschränkt. Der Kaiser konnte die Regierungsmitglieder unabhängig von der Mehrheit der Abgeordneten ernennen. Wenigstens nationalliberale Bürgerliche dürften sich als Gewinner gesehen haben, konnten sie zumindest in der wirtschaftlichen Sphäre relativ frei walten. Auf die Umsetzung liberaler Ideale mussten sie indessen verzichten. Hervorzuheben ist die auf Ausgleich bedachte Außenpolitik in der Bismarck-Ära. Der „ehrliche Makler“ ist auch heute noch ein Vorbild für jene Kreise, die eine ausschließliche Westorientierung aus den Zeiten Adenauers nicht für alle Ewigkeit als in Stein gemeißelt betrachten.
Die Historiographie hat einen „Machtstaat vor der Demokratie“ (Thomas Nipperdey) konstatiert. Dieser Mangel war für Wilhelm II. kein Grund zur Trauer, verspottete er doch den Reichstag, der heute wie ein Monument aus ferner Zeit in das „bunte“ Berlin hineinragt, als „Reichsaffenhaus“. Die meisten Zeitgenossen dürften diesen Nachteil kaum wahrgenommen haben, waren die Prägungen im damaligen Obrigkeitsstaat signifikant andere als die heutigen. Gerade im wilhelminischen Zeitraum fiel der verbreitete Untertanengeist auf und wurde in etlichen Romanen – prominent in Heinrich Manns „Der Untertan“ – karikiert.
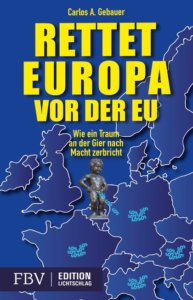 Kontinuitäten von „1871“ bis zur NS-Diktatur lassen sich durchaus ausmachen. Doch lobten auch ausländische Beobachter öfters die „Nicht-Demokratie“ als zukunftsfähigen Rechtsstaat mit moderner Verwaltung. Zu den rechtsgeschichtlich heute noch bedeutsamen Errungenschaften gehört das 1900 in Kraft gesetzte Bürgerliche Gesetzbuch. Die damit in die Wege geleitete moderne Sozialgesetzgebung fand etliche Nachahmer. In der Summe ist für den neuen Staat die Bezeichnung „konstitutionelle Monarchie“ nicht unangemessen.
Kontinuitäten von „1871“ bis zur NS-Diktatur lassen sich durchaus ausmachen. Doch lobten auch ausländische Beobachter öfters die „Nicht-Demokratie“ als zukunftsfähigen Rechtsstaat mit moderner Verwaltung. Zu den rechtsgeschichtlich heute noch bedeutsamen Errungenschaften gehört das 1900 in Kraft gesetzte Bürgerliche Gesetzbuch. Die damit in die Wege geleitete moderne Sozialgesetzgebung fand etliche Nachahmer. In der Summe ist für den neuen Staat die Bezeichnung „konstitutionelle Monarchie“ nicht unangemessen.
In der Rückschau überwog nichtsdestotrotz die Distanzierung davon, die in der Geschichtsschreibung in prominenter Weise die sozialhistorische Schule Hans-Ulrich Wehlers verkörperte. Deren Opponenten, etwa der Münchner Gelehrte Thomas Nipperdey, widersprechen nicht den materialreich untermauerten Hinweisen auf politische Defizite. Sie führen aber an, dass das Deutsche Reich in manchen Bereichen hohe Standards erreichen konnte, etwa auf den Feldern von Bildung und Wissenschaft, der technischen Entwicklung, der Industrieproduktion, auf den breiten Sektoren der Kultur und so fort.
Auf dieser Linie plädiert der Historiker Jens Jäger in seiner Studie „Das vernetzte Kaiserreich“ dafür, die Modernitätspotenziale des gern als altertümlich betrachteten Regiments nicht zu unterschätzen. Er nennt die verdichteten Kommunikationsnetze, die sich vor 1914 entwickelten: Post, Telegramm und Telefon, als Beispiele. Die Phonoindustrie hob an. Um 1900 revolutionierten Omnibusse und Fahrräder den Verkehr. Die Presselandschaft erwies sich als erstaunlich diversifiziert und agierte überwiegend unbehindert. Eisenbahn- und Schifffahrtsverbindungen wurden enorm wichtig für die in den 1880er Jahren sich immer deutlicher abzeichnende Globalisierung. Diese ist nicht vollkommen identisch mit dem imperialistischen Ausgriff diverser Großmächte, sondern berührt zahllose Facetten sozialer, wirtschaftlicher, politischer und sonstiger Interaktionen zwischen Europa und anderen Kontinenten.
Dass die heute meist postnational ausgerichteten Deutungseliten mit nationalen Traditionen fremdeln und das Deutsche Kaiserreich von 1871 bis 1918 zum Vorläufer des Dritten Reiches verkürzen, ist nur aus einer voreingenommenen Sicht begreiflich. Stark ambivalente Strömungen wie Nationalismus und Patriotismus, die auch integrativ wirken können, verschwinden nun einmal nicht einfach in der Versenkung – mag man es bedauern oder nicht. 1971 schrieb der 2019 verstorbene Buchautor und Journalist Günter Zehm („Pankraz“) zum Jubiläum in der Wochenendbeilage „Geistige Welt“: „Just in diesen Tagen“ musste die deutsche Politik die Erfahrung machen, dass „sie der nationalen Frage in keinem Fall entkommen kann“. Wie viel mehr beschreibt dieser Satz in der unmittelbaren Gegenwart eine Tatsache, an der sich auch Steinmeier & Co. moralinsäuerlich abarbeiten müssen.
[themoneytizer id=“57085-3″]

Professor Dr. Felix Dirsch lehrt Politische Theorie und Philosophie. Er ist Autor diverser Publikationen, u.a. von “Nation, Europa, Christenheit” und “Rechtes Christentum“. Dirsch kritisiert unter anderem den Einfluss der 68er-Generation und der „politischen Korrektheit“.
2020 erschienen die Bücher: „Die Stimmen der Opfer. Zitatelexikon der deutschsprachigen jüdischen Zeitzeugen zum Thema: Die Deutschen und Hitlers Judenpolitik“ (zusammen mit Konrad Löw) und „Rechtskatholizismus. Vertreter und geschichtliche Grundlinien. Ein typologischer Überblick“.
Bild: Everett Collection/Shutterstock
Text: gast
Mehr von Prof. Dr. Felix Dirsch auf reitschuster.de