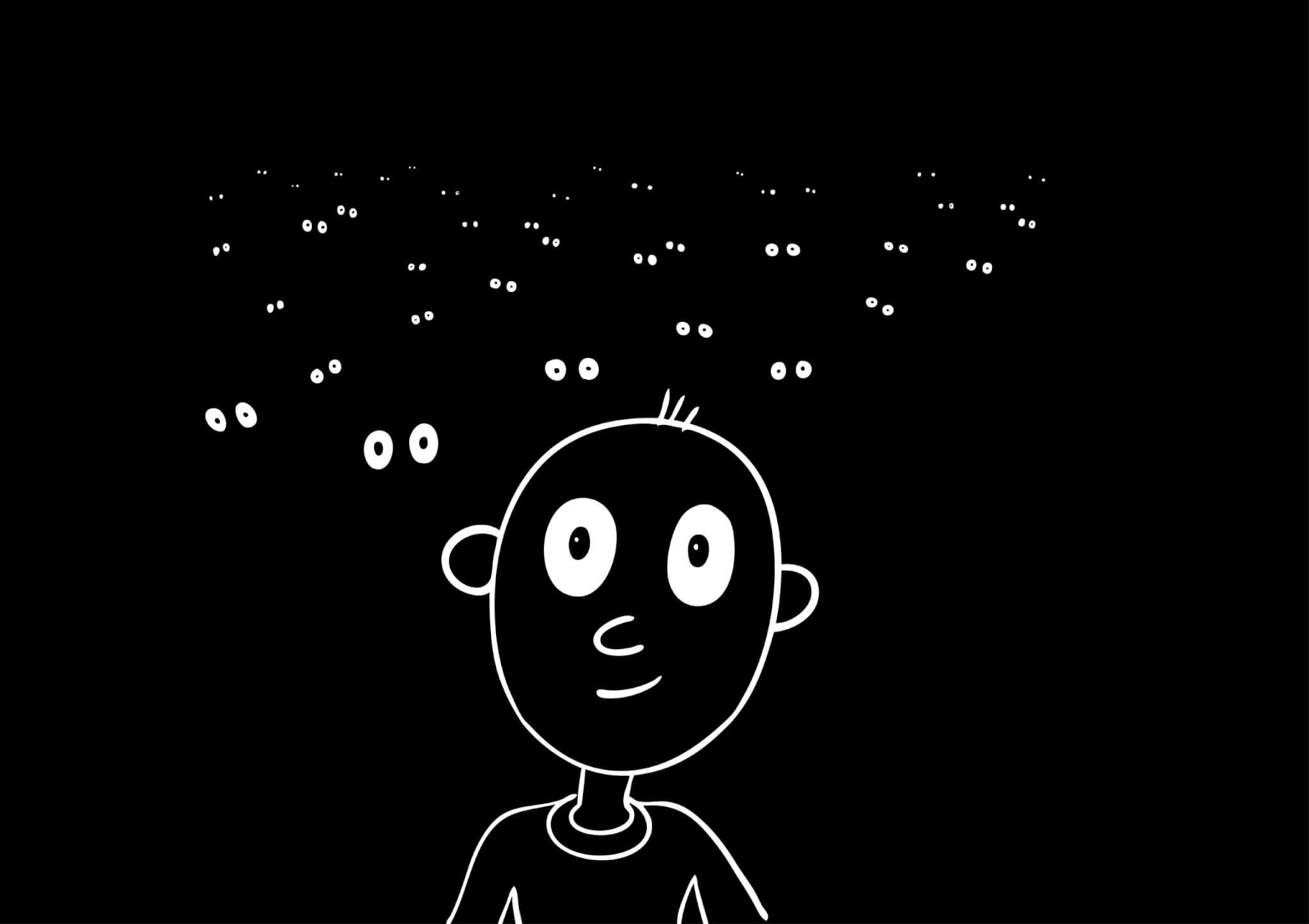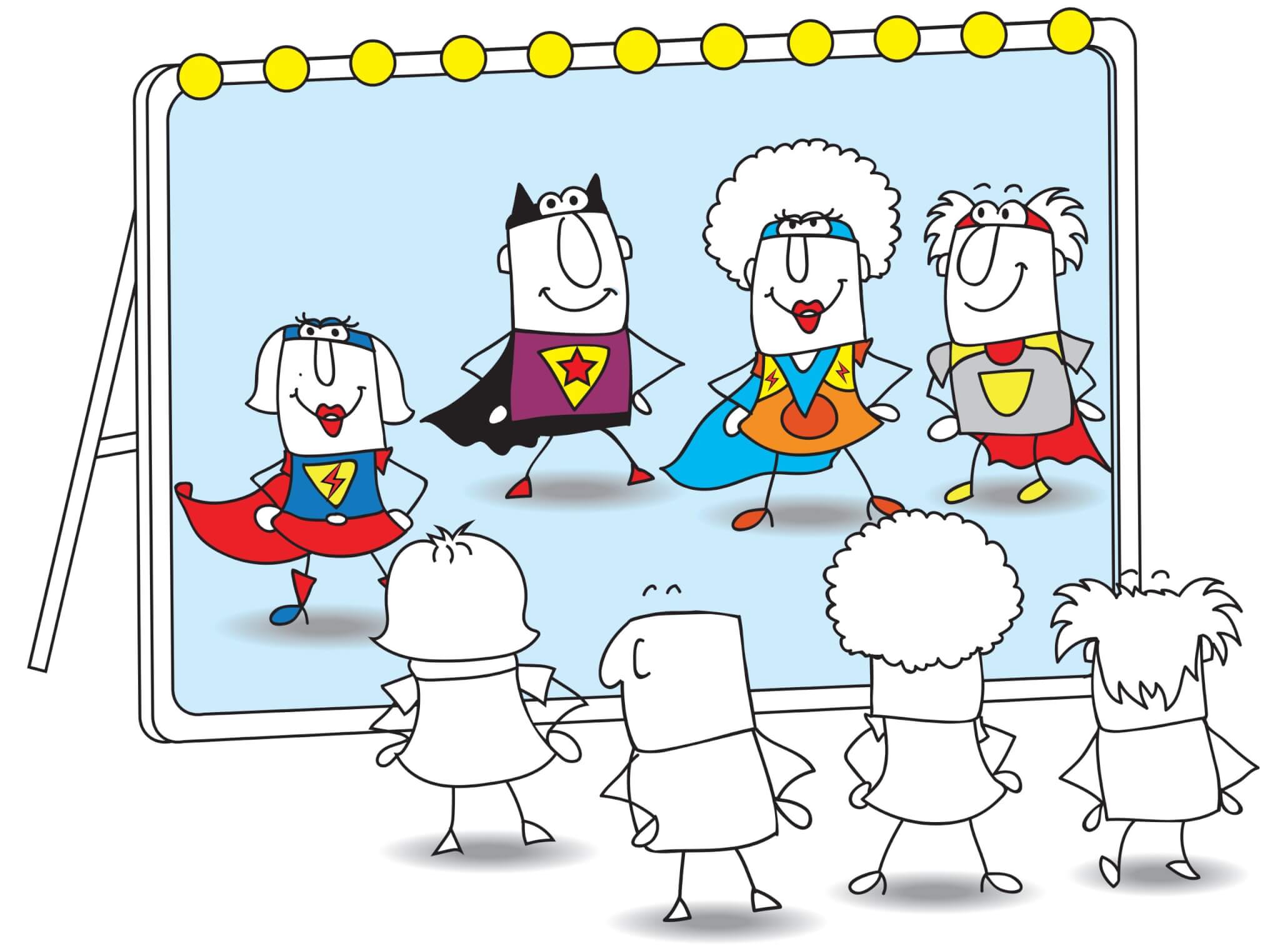Ein Gastbeitrag von Thomas Rießinger
Ferda Ataman verfügt über ein sonniges Gemüt und einen speziellen Humor. Wer erinnert sich nicht an die von ihr vom Zaun gebrochene Kartoffeldiskussion? „Wie bezeichnet man eigentlich Deutsche ohne Migrationshintergrund? Und warum reagieren Ureinheimische so empfindlich, wenn sie „Kartoffel“ genannt werden?“ So schrieb sie Anfang 2020 im Spiegel und zeigte damit deutlich ihre Neigung, andere Leute zu diskreditieren und sich dabei selbst als Opfer zu fühlen – eine Fähigkeit, die ihr im Sommer 2022 das Amt der „Unabhängigen Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung“ eingetragen hat. Dokumentiert hat sie sie mehr als einmal. Im März 2020 ließ sie im Hinblick auf Corona-Patienten verlauten: „Ich habe irgendwie eine Ahnung, welche Bevölkerungsgruppen in Krankenhäusern zuerst behandelt werden, wenn die Beatmungsgeräte knapp werden.“ Und damit niemand auf die Idee kommt, sie könnte vielleicht Grünen-Politiker als besonders gefährdet betrachten, legte sie noch nach: „Doch viele Menschen aus Einwandererfamilien treibt die Angst vor Rassismus um, auch in der Corona-Krise. Sie denken darüber nach, welche Folgen institutioneller Rassismus in einem drohenden Ausnahmezustand haben kann.“
Das ist ihr Geschäftsmodell: Man unterstelle und diffamiere, was das Zeug hält, um sich dann als Kämpfer gegen eine vermeintliche und herbeigeredete Diskriminierung präsentieren zu können. Was ihre berufliche Laufbahn angeht, hat das offenbar ausgezeichnet funktioniert. Dass sie damit außerhalb der üblichen Kreise der hauptberuflich Dauerbetroffenen nicht immer auf Begeisterung stößt, zeigt beispielsweise ein offener Brief der „Migrantinnen für Säkularität und Selbstbestimmung“ vom Sommer 2022, in dem sehr deutlich gezeigt wird, dass Ataman „andere Meinungen mit Diffamierungen“ erstickt und mit ihrem Schwarz-Weiß-Denken „nicht nur für Spaltung und Ressentiment in der Gesellschaft“ sorgt, sondern auch ihrerseits Diskriminierung legitimiert. An ihrer Berufung zur Antidiskriminierungsbeauftragten hat das nichts geändert; warum sollte sich eine Bundesregierung auch um die Meinung der wirklich Betroffenen oder gar um Argumente kümmern?
Und sie füllt ihr Amt auf die altvertraute Weise aus, wie sie gerade wieder unter Beweis gestellt hat. Denn sie ist mit dem vorhandenen „Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz“ nicht zufrieden, weshalb sie am 19. Juli ein „Grundlagenpapier“ zur Reform dieses Gesetzes vorlegte, mit dem sie „Menschen in Deutschland besser vor Diskriminierung schützen“ will. „Es sei an der Zeit“, liest man bei der Antidiskriminierungsstelle, „dass Deutschland ein Antidiskriminierungsrecht bekomme, das modernen und europäischen Standards entspreche.“
Ominöses Grundlagenpapier
Welch hehres Ziel! Man vermisst zwar ein wenig den Nachweis, dass die deutsche Gesetzgebung den Standards anderer europäischer Staaten oder gar dem Grundprinzip der Modernität hinterher hinkt, aber auf solche Einzelheiten verzichtet es sich leicht, wenn es um die gute Sache geht.
Was verrät uns nun das ominöse Grundlagenpapier? In seinem ersten Vorschlag lesen wir, man wolle „mehr Menschen vor Diskriminierung schützen – Diskriminierungsmerkmale erweitern“. Wer nun eine leichte Hoffnung verspürt, man wolle Phänomenen wie der massiven Diskriminierung Ungeimpfter während der sonderbaren Pandemie ein Ende setzen, sieht sich schnell enttäuscht, denn für solche konkreten und nachweisbaren Diskriminierungen interessieren sich Weltverbesserer nicht. Den bisherigen Stand des Diskriminierungsschutzes zeigt §1 des Gleichbehandlungsgesetzes: „Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen.“ Das sind die Tatbestände, um die es bisher ging, und natürlich sind es für Ataman viel zu wenige. Entgangen ist ihr allem Anschein nach, dass man sich auch einmal um die derzeit vorhandenen Ziele kümmern könnte. Solange beispielsweise der gewählte Landrat von Sonneberg nach seiner Wahl erst einmal eine Gesinnungsprüfung bestehen musste – als erster seiner Berufsgruppe – um sein Amt tatsächlich anzutreten, weil er einer Partei mit unliebsamer Weltanschauung entstammt, kann man kaum behaupten, dass in Deutschland niemand wegen seiner Weltanschauung diskriminiert würde. Und solange man in Stellenanzeigen für Professorenstellen noch immer Sätze wie „Frauen werden daher ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert“ findet, die stark darauf hinweisen, dass man an Bewerbungen von Frauen mehr interessiert ist als von Männern, ist eine Benachteiligung wegen des männlichen Geschlechts nicht von der Hand zu weisen.
Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit und des 'sozialen Status'
Aber lassen wir diese Kleinlichkeiten und wenden uns den neuen Vorstellungen der umtriebigen Beauftragten zu. Es würde zu weit führen, alle Punkte durchzugehen, einige wesentliche müssen genügen. Wie schon erwähnt, will Ataman den Merkmalen des §1 noch weitere hinzufügen, darunter die Merkmale „Staatsangehörigkeit“ und „sozialer Status“. Das kann zu interessanten Konsequenzen führen. In aller Regel wird man einem Träger der deutschen Staatsangehörigkeit problemlos einen deutschen Pass ausstellen, auch wenn es mittlerweile Bestrebungen gibt, Zeitgenossen mit missliebigen Auffassungen von diesem Recht auszuschließen und ihnen den Pass zu entziehen. Ohne deutsche Staatsangehörigkeit ist das ohne Zweifel etwas schwieriger. Aber das ist doch eindeutig eine Benachteiligung aufgrund der Staatsangehörigkeit, und will man dieses Merkmal konsequent verfolgen, so bleibt den Behörden nichts anderes übrig, als den Angehörigen beliebiger Staaten einen deutschen Pass auszustellen, wenn sie sich nicht dem Verdacht schwerster Diskriminierung infolge der Staatsangehörigkeit aussetzen wollen. Fürchterlich viel würde das auch gar nicht mehr ausmachen, bei den Sozialleistungen ist es ja schon heute so.
Auch der soziale Status als Merkmal verdient einige Worte. Der Begriff hat mehrere Bedeutungen, aber „die am weitesten verbreitete Verwendungsweise bezieht sich auf die vertikale sozio-ökonomische Verortung einer Person oder einer Personengruppe in einer Gesellschaft.“ Kurz gesagt: je mehr Geld, desto besser der Status. Nun soll es aber nach dem Willen der fleißigen Beauftragten keinerlei Benachteiligungen wegen des sozialen Status mehr geben. Da werden sich Vermieter aber freuen, wenn man ihnen bald ausdrücklich verbieten wird, den Mietinteressenten Informationen über ihr Einkommen abzuverlangen oder selbst Auskünfte einzuholen – man könnte ja jemanden, der die Miete nicht bezahlen kann, wegen seines sozialen Status benachteiligen, und das muss mit allen Mitteln vermieden werden. Von der Prüfung der Kreditwürdigkeit will ich erst gar nicht reden, vermutlich wird bald niemand mehr auf Sicherheiten bei der Kreditvergabe bestehen dürfen, weil auch im Zusammenhang mit Krediten niemand mit einem eher niedrigen pekuniär orientierten sozialen Status schlechter behandelt werden darf.
Doch die Medaille hat mehrere Seiten, denn „weiter gefasst meint sozialer Status die hierarchische Verortung einer Person oder Personengruppe in einem Sozialsystem … auf Basis einer ihr entgegengebrachten Wertschätzung.“ Wir erinnern uns daran, welch ungeheure Wertschätzung denen entgegengebracht wurde, die sich während der sonderbaren Pandemie gegen die Teilnahme an einem weltweiten gentechnischen Experiment entschieden. Tobias Hans, der sehr zu Recht vergessene frühere Ministerpräsident des Saarlandes, brachte seine Wertschätzung Ende 2021 klar zum Ausdruck: „Zuerst einmal müssen wir eine klare Botschaft an die Ungeimpften senden: Ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben.“ Tiefer kann man in der hierarchischen Verortung nicht sinken, und auf der Basis dieses miserablen sozialen Status hat man den Ungeimpften ihre Grundrechte verweigert. Sollte sich wieder einmal jemand eine sonderbare Pandemie ausdenken, dann wird Ferda Ataman dafür sorgen, dass alle, aber auch wirklich alle, unabhängig vom sozialen Status, unabhängig von der gesellschaftlichen Wertschätzung gleich behandelt werden. Wer daran Zweifel äußert, macht sich unter Umständen der verfassungsschutzrelevanten Deligitimierung des Staates schuldig.
'Hohes Diskriminierungsrisiko durch KI
Am schönsten ist allerdings die Idee, in Zukunft den „Schutz vor Diskriminierung durch künstliche Intelligenz“ in §3 des Gesetzes aufnehmen zu wollen. §3 liefert zwar nur einige Begriffsbestimmungen zu der Frage, was man generell unter Benachteiligungen und Belästigungen verstehen soll, während die konkreten Merkmale in §1 gehören, aber man muss ja nicht zu formalistisch werden. Im Grundlagenpapier wird festgestellt, „die Systeme“ würden nur vermeintlich objektiv entscheiden, da sie auf verschiedensten Grundlagen und auch Vorurteilen aufbauen: „Dabei kann ein hohes Diskriminierungsrisiko bestehen.“ Das „Handeln durch automatisierte Entscheidungssysteme … sollte als Benachteiligungstatbestand in § 3 AGG aufgenommen werden.“ Das stößt auf Schwierigkeiten. In ein klassisches Programm aus alter Zeit kann man irgendwelche Daten eingeben, und je nach Ausgestaltung des Algorithmus wird das Programm eine Ausgabe liefern. Es stimmt: Das kann z.B. auch eine Entscheidung sein. In diesem Fall ist es aber ein Leichtes, die im Algorithmus verwendeten Kriterien herauszufinden, da sie ja im Programm und seiner Dokumentation abgelegt sein dürften, und dann auf der Basis dieser Kriterien festzustellen, ob sie etwas mit den Merkmalen des Gesetzes zu tun haben oder nicht. Dazu braucht man keinen neuen Tatbestand.
Handelt es sich jedoch um so etwas wie die viel beschworene künstliche Intelligenz, ist die Sachlage anders, man spricht hier gerne vom maschinellen Lernen. „Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Trainieren von Computern, um aus Daten und Erfahrungen zu lernen und sich stets zu verbessern – anstatt explizit dafür programmiert zu werden.“ Und da man vorher nicht weiß, was und wie hinterher gelernt wird, weiß man auch nicht unbedingt, nach welchen Kriterien eine maschinelle Entscheidung erfolgt. Das interessiert die erfindungsreiche Beauftragte auch nicht. Ihr geht es nicht um die Kriterien, sondern gleich darum, dass das „Handeln durch automatisierte Entscheidungssysteme“ in jedem Fall ein Benachteiligungstatbestand ist, egal wie eine jeweilige Entscheidung ausfällt. Wann immer also eine Entscheidung algorithmisch durch eine künstliche Intelligenz gefällt wird, will sie dafür sorgen, dass automatisch von einer Benachteiligung ausgegangen wird. Warum jemand schon dadurch diskriminiert werden soll, dass eine Entscheidung – und sei es auch im Sinne des Betroffenen – auf algorithmischer Basis herbeigeführt wird, erschließt sich vermutlich nur der besonders begabten Beauftragten.
Je mehr Benachteiligungen, desto wichtiger ist das Amt
Es dürfte nicht schwer zu erraten sein, zu welchem Zweck all diese Tatbestände und Merkmale dem Gesetz hinzugefügt werden sollen: Je mehr Benachteiligungen man sich ausdenkt, desto wichtiger wird das Amt der Beauftragten, an die sich alle Mühseligen und Beladenen wenden sollen. Da ist es kein Wunder, dass sie den „Nachweis von Diskriminierungen erleichtern“ und gleichzeitig ihre eigenen Befugnisse erweitern will. Bisher verlangt das Gesetz, wie man dem Grundlagenpapier entnehmen kann, dass „das Vorliegen der Benachteiligung ebenso wie das Vorliegen der Indizien vollumfänglich bewiesen werden“ muss. So kann das nicht bleiben. Wo kämen wir denn hin, wenn man für eine Anklage auch noch Beweise vorlegen müsste? Ich gebe zu, für Atamans Idee gibt es prominente Vorbilder, allen voran die MeToo-Bewegung, bei der man davon ausgeht, dass jede vorgebrachte Anklage eine Verurteilung nach sich zu ziehen hat. Aber auch unsere hochkompetente Bundesinnenministerin hat zur Verfestigung solcher Vorstellungen beigetragen, als sie sich dafür aussprach, bei bestimmten Disziplinarverfahren einfach die Beweislast umzukehren, sodass man sich nicht mehr mit der lästigen Unschuldsvermutung herumärgern muss und der Beklagte gefälligst seine Unschuld beweisen soll. Für den Ankläger ist das ausgesprochen praktisch, und deshalb fordert Ataman in ihrem fünfzehnten Punkt: „Das Erfordernis, eine Benachteiligung und Indizien nachzuweisen, sollte auf die Glaubhaftmachung herabgesenkt werden, das heißt, dass die überwiegende Wahrscheinlichkeit genügt.“
Glaubhaft machen muss der Betroffene seine Aussage, doch wem gegenüber? Berichtet man dem Papst über die heilige Dreifaltigkeit, so ist anzunehmen, dass er zumindest das Grundprinzip äußerst glaubhaft findet, überzeugte Atheisten würden das anders sehen. Genau deshalb setzt man üblicherweise auf Beweise, weil der pure Glaube an einen Sachverhalt keineswegs nur vom geschilderten Sachverhalt, sondern unter anderem auch von der Person des Zuhörers abhängt. Wer dem generellen Glauben anhängt, dass Muslime ständig und überall von allen diskriminiert werden, der wird jede Einzelfallschilderung ohne Weiteres als glaubhaft betrachten. Das Kriterium der Glaubhaftigkeit ist ein Kriterium der Beliebigkeit und der Willkür.
Aber die bahnbrechende Beauftragte hat es ja präzisiert: Die überwiegende Wahrscheinlichkeit soll genügen. In der Wahrscheinlichkeitsrechnung wird man diesen Begriff eher selten finden, bei der Würdigung von Beweisen vor Gericht kommt er vor, und er bedeutet, dass „in der Gesamtschau … die Umstände mehr für als gegen eine Tatsache sprechen“ müssen. Das macht es nicht besser. Wie hoch soll denn die Wahrscheinlichkeit sein? Vielleicht knapp über 50 Prozent? Vielleicht mehr als 70 oder gar 95 Prozent? Und wie soll man sie überhaupt bestimmen? Vermutlich doch nur grob anhand der Glaubhaftigkeit dessen, was da vorgetragen wurde, andere Kriterien hat man nicht. Und so ergibt sich, dass Glaubhaftigkeit auf die überwiegende Wahrscheinlichkeit zurückgeführt wird, die allerdings auf der Glaubhaftigkeit des Vorgetragenen beruht. Manche Leute drehen sich gern im Kreis und halten das für ein Argument.
Die Qualität eines Nachweises wird so auf Wortgeklingel reduziert, und genau das ist Sinn der Sache. Bisher müssen die Betroffenen einer vermuteten Diskriminierung „Indizien dafür darlegen, dass die nachteilige Behandlung auf einem geschützten Merkmal beruht“, lesen wir im Grundlagenpapier, und genau das will die begeisterte Beauftragte abschaffen zugunsten des dehnbaren und wachsweichen Kriteriums der Glaubhaftigkeit, ohne Indizien, ohne Beweise. So sieht der deutsche Rechtsstaat aus.
Wer also glaubt oder sich auch nur wünscht, Opfer einer Benachteiligung im Rahmen bestimmter Merkmale zu sein, muss sie in Zukunft nur noch behaupten, möglichst ohne sich dabei allzusehr in Widersprüche zu verwickeln – das könnte der Glaubhaftigkeit vielleicht ein wenig schaden. Aber das reicht nicht, denn, so das Grundlagenpapier, „Opfer schrecken oft vor der Geltendmachung ihrer Rechte zurück“, wodurch ein „Wirksamkeitsdefizit“ des Diskriminierungsschutzes entsteht. Es ist daher nicht überraschend, dass Ataman ein bisher nicht vorgesehenes Verbandsklagerecht für „Antidiskriminierungsverbände“ einführen will, was nur bedeutet, dass ein Verband oder ein Verein auch dann Klage erheben kann, wenn es nicht um die eigenen Rechte geht, sondern um die Rechte der Allgemeinheit. Das kennt man schon von Klagen in Umweltfragen, wo sich insbesondere die Deutsche Umwelthilfe als besonders aktiver Nutzer des Verbandsklagerechts betätigt. Die Folgen sind klar. Kaum wäre das Verbandsklagerecht installiert, würde eine Deutsche Diskriminierungshilfe, vielleicht auch ein Deutscher Antidiskriminierungsunterstützungsverband – für beide Namen beanspruche ich schon vorsorglich das Urheberrecht – aus der Taufe gehoben, der nichts anderes zu tun hätte, als Klagen auf der Basis der Glaubhaftigkeit sogenannter Betroffener zu führen und sich insbesondere mit einer Unzahl von Abmahnungen ein kleines Nebeneinkommen zu verschaffen. So schafft man neue Geschäftsmodelle und bringt Vermieter dazu, ihre Wohnungen künftig für sich zu behalten oder nur noch an persönliche Bekannte zu vergeben. Ob das im Sinne der begeisternden Beauftragten liegt, kann ich nicht wissen.
Sie geht aber noch einen Schritt weiter, denn die Klageerhebungen machen keinen rechten Spaß, wenn man sie anderen überlässt. In Punkt 18 ihres Grundlagenpapiers teilt man uns mit: „Die Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung sollte ein altruistisches Klagerecht erhalten.“ Auch bei einem altruistischen Klagerecht „handelt es sich um die Geltendmachung der Rechte der Allgemeinheit,“ es heißt nur etwas anders. Ataman will also überall dort, wo es eigentlich keine Kläger gibt, selbst Klage wegen Diskriminierung erheben dürfen, und man kann sich leicht vorstellen, in welche Höhe dann die Anzahl der Klagen schnellen würde, da ein Klagerecht, das man nicht ausübt, keine Freude bereitet. Dass auf diese Weise hauptberuflich Interessierte Benachteiligungen konstruieren können, für die sich kein Kläger finden lässt, weil es keinen gibt, dass man angeblich Betroffene mit sanfter Überredung zu Opfern machen kann, obwohl sie bisher ihren Opferstatus noch gar nicht bemerkt haben, nur um die Bedeutung der eigenen Behörde in den Vordergrund zu rücken – das alles spielt in der Welt einer beeindruckenden Beauftragten keine Rolle.
Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, lesen wir in Punkt 19 auch noch die Forderung, die Antidiskriminierungsstelle „sollte die Möglichkeit zu einer verpflichtenden Schlichtung erhalten, sofern die betroffene Person dies wünscht.“ Man stelle sich vor: Die Stelle, die sich gerade eben das Klagerecht ernörgelt hat, will nun die Rolle einer Schlichtungsstelle spielen. Ist das nicht großartig? So kann man dem Gegner erst mit einer Klage drohen und ihm dann – als Zeichen der eigenen Großzügigkeit – ein Schlichtungsverfahren anbieten, bei dem man immer dann, wenn der Gegner eine abweichende Meinung zu äußern wagt, auf die jederzeit bestehende Möglichkeit einer gerichtlichen Klage hinweisen kann. Die Objektivität einer solchen Schlichtung liegt auf der Hand.
Niemand muss sich wundern. Die Vorstellungen der beachtlichen Beauftragten passen sehr genau in das „beste Deutschland, das es jemals gegeben hat“. Wir haben einen Bundespräsidenten, der das Prinzip der Überparteilichkeit nicht übermäßig hoch bewertet. Wir haben einen Wirtschaftsminister, der die Wirtschaft ruiniert und die Menschen bis in ihre Heizungskeller verfolgt. Wir haben eine Innenministerin, die sich nicht um rechtsstaatliche Prinzipien kümmert. Wir haben einen Leiter des Verfassungsschutzes, der seine Behörde als Schutz der Regierung vor der Verfassung versteht. Was soll man dann von einer Antidiskriminierungsbeauftragten erwarten? Nur eines: Dass sie ungehemmt ihren ideologischen Vorstellungen nachgeht, dass sie kein Problem löst und viele schafft. So arbeiten die Beauftragten der Bundesregierung, so arbeitet auch die Bundesregierung selbst.
Das Land wird ruiniert, und alle sehen zu.
Sie entscheiden – mit Ihrer Hilfe!
Mein Dechiffrier-Video über die Methoden von Markus Lanz hat das ZDF dreimal auf Youtube sperren lassen. Der Schuss ging nach hinten los. Ich habe es im freien Internet auf Rumble hochgeladen. Da wurde es binnen weniger Tage 4,4 Millionen Mal aufgerufen. Offenbar, weil die Algorithmen „kritische“ Inhalte nicht ausbremsen wie bei Youtube. Ein Leser rechnete aus, dass damit mehr Zuschauer meine kritische Analyse der Sendung gesehen haben als die Sendung selbst. Auch mein Dechiffriert-Video zu dem Hetzstück des ZDF über Hans-Georg Maaßen wurde auf Rumble über 4,2 Millionen Mal geklickt. Das macht Mut! Aber es kostet auch sehr viel Zeit und Energie – im konkreten Fall eine Nachtschicht. Umso dankbarer bin ich für Ihre Unterstützung. Ohne die wäre meine Arbeit nicht möglich, weil ich weder Zwangsgebühren noch Steuermillionen bekomme, und auch keinen Milliardär als Sponsor habe. Dafür bin ich unabhängig!
Aktuell sind (wieder) Zuwendungen via Kreditkarte, Apple Pay etc. möglich – trotz der Paypal-Sperre: über diesen Link. Alternativ via Banküberweisung, IBAN: DE30 6805 1207 0000 3701 71. Diejenigen, die selbst wenig haben, bitte ich ausdrücklich darum, das Wenige zu behalten. Umso mehr freut mich Unterstützung von allen, denen sie nicht weh tut.
Mein aktuelles Video
Ist es obszön, wenn Frauen in der Öffentlichkeit Eis lecken? Schreiben für die Süddeutsche Talibans?


Gastbeiträge geben immer die Meinung des Autors wieder, nicht meine. Ich schätze meine Leser als erwachsene Menschen und will ihnen unterschiedliche Blickwinkel bieten, damit sie sich selbst eine Meinung bilden können.
Thomas Rießinger ist promovierter Mathematiker und war Professor für Mathematik und Informatik an der Fachhochschule Frankfurt am Main. Neben einigen Fachbüchern über Mathematik hat er auch Aufsätze zur Philosophie und Geschichte sowie ein Buch zur Unterhaltungsmathematik publiziert.
Mehr von Thomas Rießinger auf reitschuster.de