Ein Gastbeitrag von Alexander Fritsch (sehen Sie dazu auch das aktuelle Video von Boris Reitschuster)
„Wir helfen also einem ZK-Mitglied, seinen Rivalen aus dem Weg zu schaffen. Ich brauche Dir wohl nicht zu sagen, was es (…) für meine Karriere bedeutet, und für Deine.“
(„Das Leben der Anderen“, 2006)
Für diesen Text bekomme ich kein Honorar.
Normalerweise ist das nichts, womit ich Sie langweilen würde. Diesmal aber sollte es gleich am Anfang erwähnt werden. Denn es wird noch eine Rolle spielen, Sie werden sehen.
„Ein Journalist erwirbt das Vertrauen eines Menschen, um es dann zu missbrauchen.“
Das hat mir einst ein Funktionär des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV) gesagt. Er sagte es öfter, aber er war geschickt genug, das unter vier Augen zu tun. Also kann ich das Zitat nur ohne konkretere Quellenangabe verwenden, man wird so leicht verklagt heutzutage.
Das Zitat bildet inhaltlich durchaus eine relevante Wirklichkeit ab, das hat sich gerade in Berlin gezeigt. Dort hat, ungewöhnlich genug, ein Journalist der Süddeutschen Zeitung (SZ) einen Kollegen um ein Interview gebeten. Beide kennen sich seit 15 Jahren, auch privat, waren zusammen sogar schon einmal in der Sauna. Da geht man ja auch nicht mit jedem hin.
Kurz vor dem Treffen ruft der SZ-Mann an: Ob er noch jemanden aus seiner Redaktion mitbringen dürfe. Zwei gegen einen also. Der Interviewpartner ist ein höflicher Mann, darauf zählen die SZ-Leute: Er stimmt zu. Er geht – was in dieser Konstellation fraglos angebracht gewesen wäre – selbst dann nicht sofort wieder, als sein alter Kollege einen ganz anderen als den angekündigten SZ-Menschen zum Interview mitbringt.
Wir werden fair sein, sagen sie.
Im Ergebnis schreiben die beiden SZ-Männer mithilfe von noch einem weiteren dann einen Artikel, den man auch bei nüchterner Betrachtung kaum anders denn als Rufmordversuch lesen kann.
Es fällt einem die DDR-Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld ein. Wie mag sie sich wohl gefühlt haben, als sie nach der Wende in ihrer Stasi-Akte lesen musste, dass sie jahrelang von ihrem eigenen Ehemann bespitzelt worden war? „Ein Journalist erwirbt das Vertrauen eines Menschen, um es dann zu missbrauchen.“ Der Mann, den die Süddeutsche Zeitung jetzt zu vernichten versucht, ist Boris Reitschuster.
Aber auch Denunzianten sind nicht mehr das, was sie mal waren.
Die Recherche hat viele Fehler. Einfachste Dinge werden verwechselt: Überschriften mit Intros, Gastbeiträge auf Reitschusters Internetportal mit Reitschusters eigenen Texten. Anfängerfehler. Ein Zitat, das ihm zur Autorisierung vorgelegt wurde, wird nachträglich gekürzt. Unsauber, sehr sogar.
 Auch substanziell hapert es, der Text enthält schlichte Falschbehauptungen. Er habe nach offiziellen Pressekonferenzen zwar nicht geheime, aber persönliche Gespräche von anderen Journalisten mit Regierungssprechern „gefilmt“, heißt es. Tatsächlich hat Reitschuster diese Szenen ausschließlich fotografiert. Das ist ein gewaltiger Unterschied: Genau solche Fotos, erstens, werden standardmäßig von Dutzenden Fotografen gemacht. Reitschuster tat also – anders, als die SZ es ihren Lesern weismachen will – nichts anderes als alle anderen auch. Und Fotos, zweitens, haben keinen Ton. Anders als bei Videos können also keine vertraulichen Gesprächsinhalte ungewollt offenbart werden.
Auch substanziell hapert es, der Text enthält schlichte Falschbehauptungen. Er habe nach offiziellen Pressekonferenzen zwar nicht geheime, aber persönliche Gespräche von anderen Journalisten mit Regierungssprechern „gefilmt“, heißt es. Tatsächlich hat Reitschuster diese Szenen ausschließlich fotografiert. Das ist ein gewaltiger Unterschied: Genau solche Fotos, erstens, werden standardmäßig von Dutzenden Fotografen gemacht. Reitschuster tat also – anders, als die SZ es ihren Lesern weismachen will – nichts anderes als alle anderen auch. Und Fotos, zweitens, haben keinen Ton. Anders als bei Videos können also keine vertraulichen Gesprächsinhalte ungewollt offenbart werden.
„Gegendarstellungsfähig“ heißt so etwas im Presserecht. In der Regel ist es ein Merkmal für unterirdisch schlechtes Handwerk.
Ergänzt wird das durch eine geradezu lustige Selbstentlarvung.
Man wirft Reitschuster vor, von einem Leser, den er auf einer Demonstration getroffen hatte, 20 (in Worten: zwanzig) Euro für sein Portal angenommen zu haben. Er lasse sich „von Leuten Geld geben, über die er berichtet“, schreiben die SZ-Inquisitoren.
Den Herren muss irgendwie entgangen sein, dass sie selbst ihr Gehalt nur deshalb bekommen, weil ihre Zeitung sich über Werbung finanziert. Und natürlich nimmt die SZ gerne auch Anzeigen von Unternehmen, über die in der SZ berichtet wird. Das muss die Zeitung auch, sonst wäre sie schnell pleite – sehr schnell, denn die Texte hinter der Bezahlschranke wollen nicht ansatzweise genügend Menschen lesen, als dass man mit den Einnahmen der Paywall die Verursacher der Texte unterhalten könnte.
Warum bloß?
Die Süddeutsche braucht also Geld: weil die SZ-Leser vom Produkt nicht so begeistert sind, dass sie dafür genug bezahlen würden, um die komfortablen Gehälter und Honorare der SZ-Autoren zu refinanzieren; und weil auch das Anzeigengeschäft angesichts ständig rückläufiger Verkaufszahlen nicht gerade brummt.
Immerhin hat die Zeitung einen Weg gefunden, sich ein Stück vom öffentlich-rechtlichen Gebührenkuchen zu sichern.
Im Jahr 2014 gründete man zusammen mit dem NDR und dem WDR einen sogenannten „Rechercheverbund“. Die SZ arbeitet seitdem also teilweise kofinanziert durch Zwangsgebühren. Die ganze Konstruktion ist so fragwürdig wie nur irgendwas: Der Verband Privater Rundfunk und Telemedien, VAUNET, beklagt eine Wettbewerbsverzerrung zugunsten der Süddeutschen Zeitung, die durch beitragsfinanzierte Sender querfinanziert werde. Es handele sich im Kern um ein Zitier-Kartell.
Und das ist nicht alles.
Die SZ erscheint im Süddeutschen Verlag. Der gehört zu mehr als 80 Prozent der Südwestdeutschen Medienholding (SWMH). Die SWMH verlegt unter anderem auch die Zeitungen Freies Wort, Frankenpost, Neue Presse (Coburg) und die Südthüringer Zeitung – und zwar zusammen mit der Deutschen Druck- und Verlagsgesellschaft (DDVG).
Die DDVG gehört zu 100 Prozent der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD). Mal abgesehen von der grundsätzlichen Frage, weshalb es einer politischen Partei in Deutschland überhaupt gestattet ist, Medienunternehmen zu besitzen: Es ist jedenfalls keine Verschwörungstheorie, dass der Hauptaktionär des Süddeutschen Verlags und die SPD mindestens finanziell erhebliche gemeinsame Interessen haben. Es ist eine blanke Tatsache.
Aber natürlich hat das keinerlei Auswirkungen auf das, was in der Süddeutschen Zeitung steht. Überhaupt keine. Also wirklich: gar keine. Hare Rama, Hare Rama.
Der zweite Schurke in dem Stück ist die Bundespressekonferenz (BPK).
Das ist ein Verein, und er residiert im sogenannten Bundespressehaus in Berlin. Wenn man mit dem Taxi dorthin fährt, passiert es regelmäßig, dass die Droschke vor dem Bundespresseamt hält. Das klingt nicht nur ähnlich, es ist auch nur einen Steinwurf entfernt, der geografische Unterschied ist gering.
Der inhaltliche ist inzwischen praktisch ganz verschwunden.
Die BPK war mal eine durchaus respektable und ehrwürdige Einrichtung. Gegründet wurde sie kurz nach dem Krieg von engagierten Journalisten. Die wollten nicht mehr immer nur – wie zu Zeiten der Nazis – für Pressekonferenzen in irgendwelchen Ministerien zu Gast sein. Sie wollten auch einen eigenen Ort, wohin sie Regierungsvertreter einladen konnten, um diese zu befragen. Also Heimspiel für die Journalisten und Auswärtsspiel für die Politiker statt umgekehrt.
Dieser Ort war die BPK – erst in Bonn, dann in Berlin. Und viele Jahrzehnte wurde da auch noch richtig kritisch gefragt. Legendär der erste Auftritt von Oskar Lafontaine als neuer Finanzminister 1998: Da setzen ihm die versammelten Hauptstadtkorrespondenten so zu, dass der Saarländer vor laufenden Kameras einen kleinen Tobsuchtsanfall bekam.
Lang, lang ist’s her.
Nicht erst seit Amtsantritt der Kanzlerin Merkel, aber vor allem seitdem, geht es bergab. Statt professionelle Distanz zum Politikbetrieb zu halten, suchen immer mehr Journalisten dessen Nähe. Es gibt Gründe – ideologische, auch finanzielle: Immer mehr Journalisten wechseln als Sprecher zu Parteien, zu Abgeordneten oder in die Regierung. Es hat sich ein polit-medialer Komplex gebildet. Die BPK – formal ein eingetragener Verein – verhält sich mehr und mehr wie eine geschlossene Gesellschaft von best buddies.
Als säßen bei Pressekonferenzen überall im Saal nur noch Regierungssprecher.
Dann kommt Boris Reitschuster. Als langjähriger Moskau-Korrespondent ist er mit dem unseligen Geklüngel von Staat und Medien gut vertraut. Zurück in Berlin, beginnt er 2020, die BPK für das zu nutzen, wozu sie einst gegründet worden war: für kritische, skeptische, bohrende Fragen an Politiker.
Damit verärgert er nun gleich beide Seiten: einerseits die Politiker – die echten Journalismus und ernsthafte Fragen nicht mehr gewohnt sind und sich entsprechend dünnhäutig beim BPK-Vorstand beschweren. Andererseits verärgert Reitschuster auch die anderen Hauptstadtkorrespondenten, denen er vorführt, was sie selbst schon seit langem nicht mehr versucht hatten: Journalismus nämlich, nahe am Publikum und mit Distanz zu den Mächtigen.
Folgerichtig versucht die BPK seit einiger Zeit, Reitschuster einzuhegen: mit mahnenden Worten – oder mit Briefen, die man gut als Drohung verstehen kann. Zuletzt werden seine Wortmeldungen, nun ja, einfach übersehen: Er kann keine Fragen mehr stellen. Vertraute des BPK-Vorstands dürfen dagegen auch mehrmals per Sitzung fragen.
Und damit wären wir bei Tilo Jung.
Dessen ursprüngliches Geschäftsmodell war recht einfach: in der BPK lächerliche, im schlechtesten Wortsinn kindische Fragen stellen, die konsternierten Reaktionen filmen, alles online publizieren. Man ahnt, dass so etwas ein Publikum findet. Katzenvideos und YouPorn werden auch viel geklickt. Entsprechend nannte der Erfinder sein Programm: Jung & naiv – Politik für Desinteressierte.
Wie naiv der heute 35-Jährige wirklich ist, kann man nur vermuten. Interessiert an Geistesgeschichte und Politik ist er sehr offensichtlich nicht. „DDR war bis 89 ein autoritäres Regime. ergo rechts“, twitterte er 2020 (Orthografie aus dem Original).
Jung & doof.
Aber links, sehr links, und politisch korrekt. Folgerichtig wurde Jung inzwischen vom Kartell quasi adoptiert. Sein Mentor in der BPK ist Hans Jessen, 71, ARD-Mitarbeiter im bekanntermaßen fürstlich vergüteten öffentlich-rechtlichen Ruhestand und selbst für grüne Verhältnisse ein Linksaußen. Das einzige Foto auf seiner Wikipedia-Seite zeigt ihn zusammen mit Claudia Roth. Wer immer die Seite zusammengestellt hat, hatte offensichtlich einen feinen Sinn für Humor.
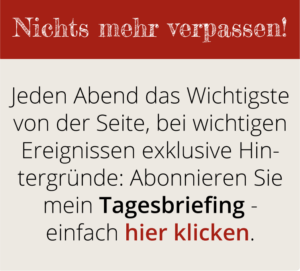 Jessen-Partner Jung zeigt zumindest Resthumor. In der SZ – die über einen Ausschluss Reitschusters aus der BPK spekuliert – lässt er sich mit dem Satz zitieren, Reitschuster mache keinen Journalismus, sondern Propaganda. Allerdings meint er das offenbar ernst.
Jessen-Partner Jung zeigt zumindest Resthumor. In der SZ – die über einen Ausschluss Reitschusters aus der BPK spekuliert – lässt er sich mit dem Satz zitieren, Reitschuster mache keinen Journalismus, sondern Propaganda. Allerdings meint er das offenbar ernst.
Was er über Reitschuster sagt, ist ehrenrührig. Aber Tilo Jung dürfte weder das Wort kennen noch dessen Bedeutung. Er gibt sich ohne Zögern als Kronzeuge für einen Text her, dessen erkennbar vorrangiges Ziel es ist, die in zwei Jahrzehnten redlich erworbene Reputation eines echten Journalisten zu demontieren.
Jung & verlogen.
Die Bundespressekonferenz will also Boris Reitschuster loswerden.
Die SZ hilft dabei mit einem Text, der seinen Autoren in Deutschland vor 85 Jahren fraglos eine blendende Karriere beschert hätte. Das sagt viel über die Autoren – und über Deutschland heute.
Es ist ein Deutschland, in dem angebliche Journalisten ihre Verfassungsprivilegien dazu nutzen, sich mittels direkter oder indirekter öffentlicher Finanzierung sowie mithilfe unverfrorener politischer Kumpanei in einem lukrativen Medienkartell häuslich einzurichten.
Für dieses Kartell ist echter Journalismus mittlerweile Feindesland.
Echter Journalismus ist immer Bürgerjournalismus: Journalismus für den Bürger nämlich – aber mit dem, also mit ihrem eigentlichen Publikum, haben die SZ, die BPK und die Tilo Jungs dieser Welt nichts, aber auch gar nichts mehr am Hut.
Sie schreiben und senden und existieren nur noch für sich selbst und ihresgleichen.
Kein Wunder, dass ihnen das Publikum davonläuft: Auch mit all den Zwangsgebührenmilliarden können die öffentlich-rechtlichen Medien seit zwei Jahrzehnten den Zuschauerschwund nicht stoppen. Und die SZ hat seit 1998 grob jeden vierten Leser verloren.
Die Leute wandern ab.
Sie wenden sich neuen Medien zu, die sie (aus gutem Grund) für vertrauenswürdiger halten. Wer braucht schon eine Zeitung, die ihre Leser belehrt statt informiert, die erziehen will statt aufzuklären, die nicht mit kritischen Fragen die Regierung kontrolliert – sondern stattdessen lieber kritisch fragende Journalisten attackiert?
Eben. Keiner braucht die.
Anders als die SZ-Mitarbeiter für ihre Agitprop-Fingerübung, bekomme ich für diesen Text kein Honorar. Er ist – im offensichtlichen Gegensatz zum süddeutschen Rufmordversuch – auch keine Auftragsarbeit: Ich habe Boris Reitschuster darum gebeten, das hier auf seinem Portal schreiben zu dürfen.
Und ich habe die angebotene Vergütung ausgeschlagen. Wenn es um die Verteidigung eines echten Kollegen gegen erwerbsmäßige Denunzianten geht, will ich dafür kein Geld.
Aber das werden sie in München nie verstehen.
Hier geht es zu meinem Video über den Beitrag.
Und hier zum Beitrag von Alexander Wallasch zu der Causa:


Alexander Fritsch, Jahrgang 1966, studierte Volkswirtschaft und Philosophie in Frankreich und Deutschland und arbeitet seit 25 Jahren als Journalist. Außerdem berät er als Business Coach Unternehmen und Verbände, vorrangig bei den Themen Kommunikation und Strategie.
Mehr von Alexander Fritsch auf reitschuster.de









