Von Christian Euler
Während hierzulande eine Verschärfung des Lockdowns ausgemachte Sache zu sein scheint, ist Corona auf Sansibar ein Fremdwort. Die Gewürzinsel gleicht einer Parallelwelt aus Vorkrisenzeiten. Das Eintauchen in dieses Universum der Unschuld beginnt am Abeid Amani Karume International Airport. Dicht gedrängt und unmaskiert warten die müden Fluggäste auf den ersehnten Stempel im Reisepass. Ein Test für die Einreise ist ebenso wenig erforderlich wie ein aufwendiges Gesundheitsformular oder Quarantäne. Allein das flüchtige Fiebermessen gemahnt an das Virus.
Stell dir vor, es herrscht Pandemie, aber niemand wird panisch. So lässt sich die Stimmung auf der Gewürzinsel im Indischen Ozean in Anlehnung an das vielzitierte Brecht-Diktum auf den Punkt bringen. Nachdem der im März verstorbene tansanische Präsident John Magufuli sein Land im vergangenen Juni nach einem dreitägigen Gebet für coronafrei erklärte, hob auch der halbautonome Teilstaat Sansibar sämtliche Restriktionen auf.
„There is no Corona on Sansibar“, erzählt der Taxifahrer sichtlich stolz, während er lächelnd seine Zahnlücken entblößt. Die Klimaanlage in seinem maroden Toyota ist ausgefallen und macht die eineinhalbstündige Fahrt an die Ostküste während der Mittagshitze zur mobilen Sauna. Selbst im ausgebuchten Konokono Beach Resort, wo eine Nacht in einer der Villen die Reisekasse während der Hochsaison um mindestens 300 Euro erleichtert, zeugt nur ein verwaister Spender mit Desinfektionsgel an der Rezeption von der Krise.
Ausgelassenheit statt Angst
Der weiße Puderzuckerstrand blendet unter der Äquatorsonne, das Meer schimmert türkis und das Wasser ist warm wie eine Badewanne. Nur wenige Gehminuten am Strand entlang Richtung Süden künden chillige Beats von einer Beachbar. Von Mindestabstand keine Spur. Ausgelassenheit statt Angst lautet vielmehr das Motto. An den Holztischen sitzen sehr gebräunte Menschen und nippen an ihren Drinks. Einer von ihnen ist Christian D., der Sansibar als „vielleicht letztes Paradies auf diesem Planeten“ bezeichnet. Er bezeichnet sich als „Flüchtling“, ein Rückflugticket hat er noch nicht. Seinen vollen Namen möchte er nicht veröffentlicht sehen, weil er mögliche Repressalien in seiner Allgäuer Heimat mehr fürchtet als das Virus. „Ich warte ab, bis sich die Lage entspannt“, schmunzelt der Kemptener beim zweiten Kilimanjaro-Bier.
Wer die Insel kennenlernen will, darf nicht auf eine Fahrt mit dem als Daladala bezeichneten Sammelbus verzichten – dem krassen Gegenentwurf einer Corona-konformen Fortbewegung. Schon in „normalen“ Zeiten ist diese spezielle Erfahrung eher hartgesottenen Travellern zu empfehlen. Die Minibusse mit ihren schmalen Sitzen sind meist überfüllt und transportieren alles, was ein Passagier vom Markt so mitnehmen kann. Eingequetscht zwischen Einheimischen, Gemüse, Holz und bisweilen auch Matratzen gibt es keine Chance, einer möglichen Ansteckung zu entrinnen.
Alina und ihr Lebensgefährte Maxim aus der Ukraine touren bereits seit sechs Wochen um die Insel und haben ungezählte Fahrten mit dem Daladala hinter sich. Dennoch haben sie weder bei sich selbst noch bei anderen Reisenden Symptome entdeckt. Aktuell wohnen sie in einem der fünf „Upepo Beach Bungalows“ nahe des 2000-Seelen-Städtchens Bwejuu an der Ostküste der Insel. „Pole Pole“ lautet hier die Zauberformel, „langsam, langsam“. Selbst in der Hochsaison ist der endlose Strand fast menschenleer. Es sind die Weite, die Ruhe und die Wärme, die die Gäste unmittelbar in ihren Bann ziehen. Die Ostküste mit ihren kilometerlangen, fast menschenleeren Stränden zählt zu den ruhigsten Regionen auf der Gewürzinsel. Partylöwen und Feierbiester finden ihr Refugium vor allem im Norden.
Rückzugsort für Ruhesuchende
Sechs Kilometer nördlich von Bwejuu duckt sich mit „The Palms“ der Gegenentwurf zu den schlichten Strandbungalows zwischen den namensgebenden Bäumen. Die sieben opulenten, im Kolonialstil mit dunklen Hölzern und Palmdächern gestalteten Privatvillen sind sämtlich über 140 Quadratmeter groß. Um einen zentralen Pool und eine große Bar mit Restaurant herum angeordnet, wird die Ruhe hier nur durch die Brandung gestört, wenn sich die Flut nähert.
Die Hygienestandards sind sehr hoch, so dass hier selbst ängstliche Naturen unbeschwert die Seele baumeln lassen können. Das Personal trägt Maske und muss sich regelmäßig einer Fiebermessung unterziehen. Gibt es Symptome, bekommen die Mitarbeiter bezahlten Urlaub. „Wenn andere Hotels keine Maßnahmen ergreifen, halten wir dies nicht für den richtigen Weg“, unterstreicht Jaume Vilardell i Margarit bei einem südafrikanischen Cabernet Sauvignon, „es ist unser größtes Ziel, unseren Gästen einen entspannenden Aufenthalt zu bieten. Aber es ist auch unsere Pflicht, die Sicherheit unserer Gäste und unserer erstaunlichen Mitarbeiter zu gewährleisten.“
Der Katalane ist Group Manager der noblen Zanzibar Collection. Drei der vier seiner Häuser, darunter „The Palms“, zählen zu den ersten Adressen auf der Insel. Trotz des an europäischen Standards orientierten Hygienekonzepts sind im ebenfalls zur Zanzibar Collection gehörenden „Zawadi Hotel“ nur drei der zwölf Luxusvillen belegt. Das auf einer Klippe gelegene Resort ist der perfekte Rückzugsort für Ruhesuchende. Der maßgeschneiderte Service geht so weit, dass es zum Lunch keine Speisekarte gibt. Gäste sollen einfach äußern, wonach ihnen gelüstet.
Luxus mit laxen Regeln
Ausgebucht sind hingegen die 66 sämtlich mit Privatpool ausgestatteten Villen in „The Residence“. Hier tragen die Angestellten keine Maske. Leicht verblichene Aufkleber auf dem Boden gemahnen die Gäste, Abstand zu halten – was aber kaum eingehalten wird. Auch beim Dinner stehen die Tische so dicht nebeneinander wie in europäischen Vor-Corona-Zeiten. Bisweilen fühlt man sich wie in einer russischen Enklave. „Zwei bis drei Charterflüge kommen täglich auf Sansibar an, sie haben erheblich zur Auslastung der Hotels beigetragen und machen mindestens die Hälfte der monatlichen Gesamtauslastung aus“, sagt Direktionsassistent Syed Aftab – und fügt hinzu: „Sansibar fühlt sich an, als gäbe es kein Corona. Das macht die Insel zum besten Urlaubsziel. Hier können Gäste genießen, ohne an COVID-19 und die Vorsichtsmaßnahmen erinnert zu werden.“
Aftab grüßt angstfrei mit Handschlag und erläutert, dass man im gesamten Resort bewusst auf Masken verzichtet, um die Gäste nicht zu verunsichern. Einer von ihnen habe sich gleich für zwei Monate eingemietet, um dem harten Lockdown in Deutschland zu entgehen. Gut möglich, dass diese hohe Auslastung in „The Residence“ mit den laxen Regeln zu tun hat. Schwere Fälle im Zusammenhang mit dem Virus sind Aftab nicht bekannt.
Die Weltgesundheitsorganisation meldete zwischen März und Mitte Mai vergangenen Jahres 509 positiv Getestete und 21 an oder mit dem Virus Verstorbene auf der Tropeninsel. Seitdem wurden keine Fälle mehr gemeldet. „Es wird zwar getestet, aber die Ergebnisse werden nicht weitergeben. Daher gibt es keine Statistik“, weiß Christina Nett, die im Krankenhaus von Stonetown ein Praktikum absolviert. Die 23-jährige Medizinstudentin aus München hat für einen Monat hinter die Kulissen des Mnazi Mmoja Hospitals geschaut, der mit rund 780 Betten größten Klinik auf der Insel. Malerisch, nur einen Steinwurf vom Meeresufer entfernt gelegen, tun sich hinter den weißen Mauern Abgründe auf.
Tourismus ist überlebensnotwendig
Mit Parasiten befallene Katzen auf den Patientenbetten, Schimmel an den Wänden und blutverschmierte Böden durch ausgelaufene Spritzen. „Die Hygienebedingungen sind miserabel“, bringt es die gebürtige Münchnerin auf den Punkt, „ein Wunder, dass hier nicht mehr Menschen sterben.“ 25 Patienten mit den unterschiedlichsten ansteckenden Krankheiten wie Tuberkulose, Lungenentzündung oder Gelbfieber liegen dicht gedrängt in einem Raum.
Eine Isolierung der Infizierten ist nicht möglich, viele Bedienstete tragen nicht einmal Masken – teils nicht einmal im Operationssaal. Vom Desinfektionsmittel aus Orangenextrakt und Spiritus findet sich auf jeder Etage lediglich eine Flasche. „Wie viele Menschen tatsächlich mit dem Corona-Virus gestorben sind, lässt sich unter diesen Umständen nicht seriös beziffern“, meint Nett, „gäbe es massenhaft Corona-Tote, wüsste man davon auf der Insel, weil hier nur wenig geheim bleiben kann.“ In großer Zahl sterben würden die Menschen eher, wenn die ausländischen Gäste fernbleiben, glaubt die angehende Medizinerin: „Sansibar lebt vom Tourismus, an dem 70.000 direkte Arbeitsplätze und 80 Prozent der Deviseneinnahmen hängen.“ Ein Indiz, dass sich die Zahl der Infizierten – und in der Folge auch der Toten – in Grenzen halten dürfte, gibt die panafrikanische Gesundheitsbehörde CDC. Sie geht davon aus, dass 80 bis 90 Prozent der Corona-Infektionen in Afrika ohne Symptome verlaufen.
Zurück am Flughafen, drängen sich hunderte Russen vor den Check-in-Schaltern, ohne Abstand und ohne Masken. Gegen ein Trinkgeld gelingt es, sich von einem der Ordner an der endlos scheinenden Schlange vorbeischleusen zu lassen. Mit dem Verlassen des Flughafens schließen sich die Türen der Parallelwelt. „Please wear a mask“, bittet der Servicemitarbeiter die Reisegäste mit gewissem Nachdruck, bevor sie den Bus zum Flugzeug besteigen.
Nach dem obligatorischen Test, der negativ ausfällt, bleibt rückblickend die Frage: Wie sinnvoll ist der nicht enden wollende Lockdown wirklich? Klar scheint nur: Die vielfach beschworene „schlimmste Pandemie der jüngeren Geschichte“ sieht anders aus. Wer sich auf das Abenteuer Sansibar einlässt, wird reich belohnt – gerade in hierzulande wenig erbaulichen Zeiten.

Bild: Elnur/Shutterstock
Text: ce
Mehr von Christian Euler auf reitschuster.de
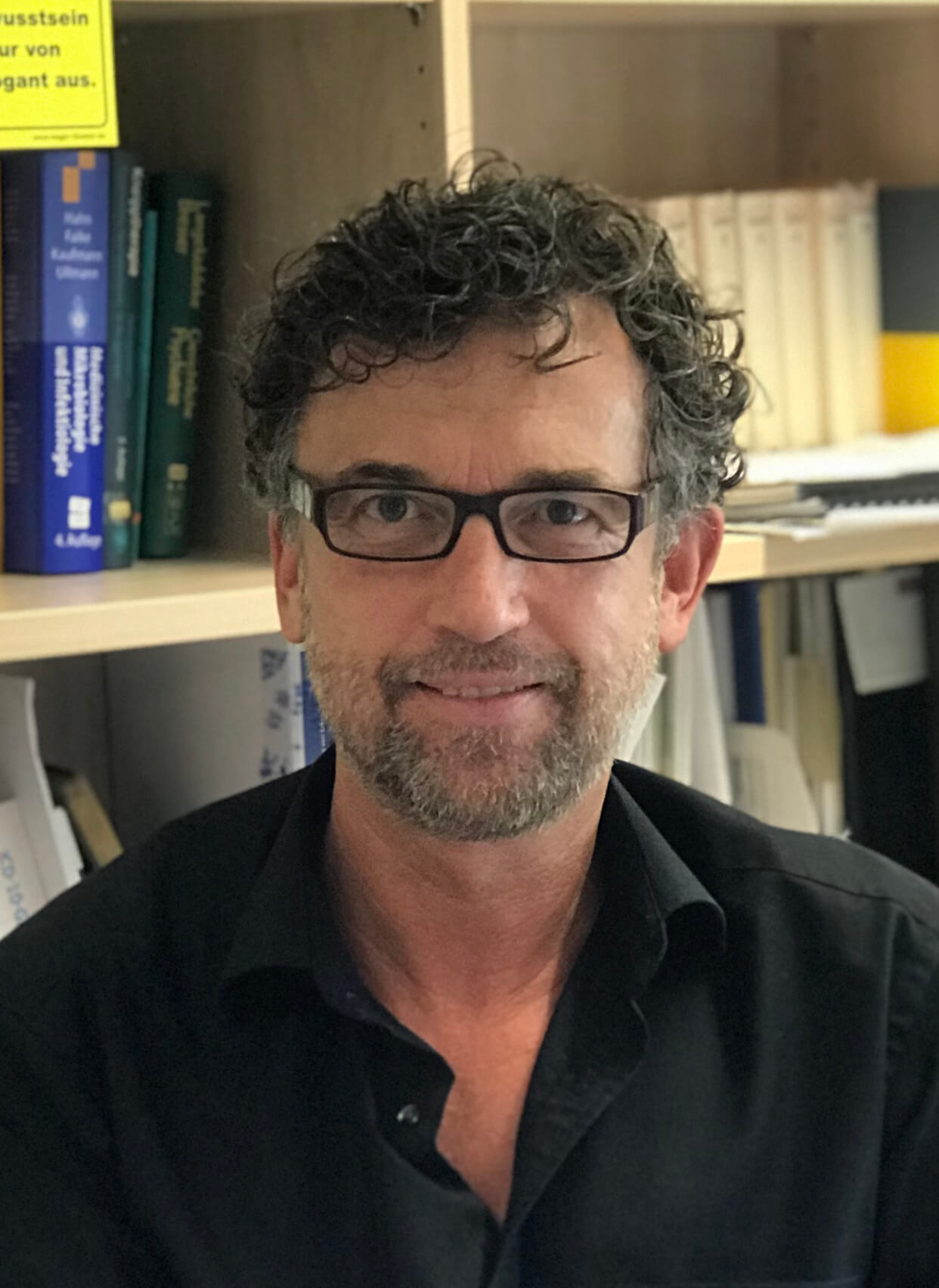


[themoneytizer id=“57085-1″]


