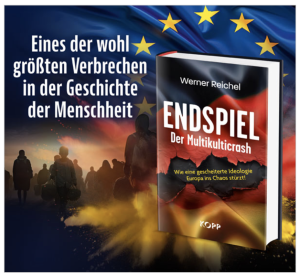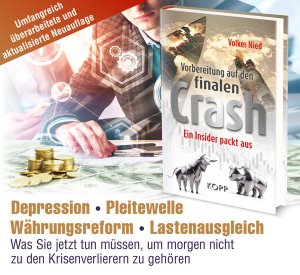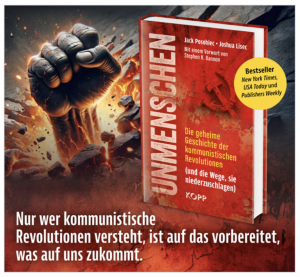Ein Gastbeitrag von Thomas Rießinger
Sie kriechen aus ihren Löchern, sie erheben die Häupter, sie werden laut und immer lauter, die Freunde von kriegerischer Rüstung. Das deutsche Gesundheitssystem beispielsweise, so Bayerns Gesundheitsministerin Gerlach, müsse auf einen möglichen Kriegsfall vorbereitet werden – und das, möchte man ihr entgegnen, obwohl es selbst im Frieden von Jahr zu Jahr dysfunktionaler wird. Und der Präsident des Bundesamtes für Katastrophenschutz verkündet, Deutschland sei zum ersten Mal seit dem Ende des kalten Krieges „einer realen Bedrohung ausgesetzt“, womit er bedauerlicherweise nicht die Politik von Friedrich Merz meint, sei aber auf diese neue Realität nicht ausreichend vorbereitet.
Andere sind noch etwas deutlicher. Der Militärhistoriker Sönke Neitzel teilte der Bild-Zeitung mit, der nächste Sommer könne vielleicht unser letzter Sommer in Frieden sein, weil es wegen Putin und Trump „eine in Bewegung geratene sicherheitspolitische Weltlage“ gebe und zudem ein großes Manöver der Russen in Belarus angekündigt worden sei. Dass Trump immerhin Versuche initiiert hat, zu einem Friedensschluss zu kommen, und dass es seit 2009 schon vier verschiedene große Militärmanöver der Russen in Belarus gegeben hat, ohne dass dabei ein Einmarsch ins Baltikum vorgekommen wäre, ist ihm vielleicht zu unbedeutend, um es zu erwähnen.
Immerhin betont er noch seine Angst vor einem Krieg. Andere machen keinen so ängstlichen Eindruck. Von den sonderbaren Strategieexperten Strack-Zimmermann und Hofreiter will ich gar nicht erst reden. Doch auch in der FAZ durfte man im März die schöne Überschrift „Deutschland ist zurück aus dem Fronturlaub“ lesen, wenige Wochen später schrieb der gleiche Autor „Deutschland macht mobil“, und nur zwei Tage später titelte das Blatt, hinter dem früher stets ein kluger Kopf gesteckt haben soll: „Noch vier Jahre bis zum großen Krieg“.
Immer stärker wird der Eindruck, man wolle nun endlich in den Krieg ziehen – ein Wunder wäre es nicht, denn wer im Frieden ein Land oder gar eine ganze Europäische Union ruiniert hat, der freut sich auf einen Krieg, dem er den selbst verursachten Ruin in die Schuhe schieben kann und den er selbst – wie fast immer bei den Kriegsfreunden – in Ruhe und Behaglichkeit überleben wird. Dem einfachen Mann, der einfachen Frau auf der Straße ergeht es für gewöhnlich anders. Man fühlt sich an die Zeit zu Beginn des Ersten Weltkrieges erinnert, als die Kriegsbegeisterung im Volk sich durchaus in Grenzen hielt und vor allem die Intellektuellen ihre Freude zum Ausdruck brachten. Deutschland habe „das Schwert gezogen gegen die Brutstätten schleichender Hinterhältigkeit“ äußerte der Physiker Max Planck, ein Satz, der heute in jeder beliebigen Talkshow fallen könnte. Und auch Thomas Mann fand eine bemerkenswerte Interpretation des Kriegsbeginns: „Es war Reinigung, Befreiung, was wir empfanden, und eine ungeheure Hoffnung“.
Obwohl man es mit den Analogien nicht übertreiben sollte, gibt es doch Ähnlichkeiten. Noch im Juli 1914 hatten Kaiser Wilhelm II. und die deutsche Regierung den bekannten „Blankoscheck“ für Österreich-Ungarn ausgestellt, mit dem sie ihre volle Unterstützung und Bündnistreue bekräftigten. Was tut die deutsche Regierung, was tut die EU-Kommission anderes als pausenlos Blankoschecks für die Ukraine im Allgemeinen und Selenskyi im Besonderen auszustellen? Die Folgen des Blankoschecks von 1914 sind bekannt. Und auch Wilhelms Thronrede von Anfang August 1914, kurz nach Kriegsbeginn, mutet fast modern und übertragbar an. Er betont, „wie meine Regierung und vor allem mein Kanzler bis zum letzten Augenblick bemüht waren, das Äußerste abzuwenden. In aufgedrungener Notwehr mit reinem Gewissen und reiner Hand ergreifen wir das Schwert“. Ähnliches könnten auch die Politiker „unserer Demokratie“ von sich geben. Sein Kanzler Theobald von Bethmann Hollweg wollte da nicht zurückstehen und gab kund: Man habe das Schwert ergriffen „gegen unseren Willen, gegen unser redliches Bemühen. Russland hat die Brandfackel an das Haus gelegt. Wir stehen in einem erzwungenen Kriege mit Russland und Frankreich“. Mit Ausnahme der letzten beiden Worte „und Frankreich“ mag Derartiges bald von einem deutschen Bundeskanzler zu hören sein, welchen Namen er auch tragen mag.
Nun gibt es zwei unabdingbare Voraussetzungen zur Kriegsführung: Geld, das man verschleudern, und Menschen, die man an die Front schicken kann. Was das Geld betrifft, so ist Deutschland bereits auf einem guten Weg. Im Zuge einer Verfassungsänderung hat der Deutsche Bundestag nicht nur ein ominöses Sondervermögen zur Förderung von Infrastruktur und Klimaneutralität eingerichtet, sondern auch beschlossen, dass der Schuldenaufnahme für die Verteidigung keine Grenzen gesetzt sein sollen; die Schuldenbremse ist für Zwecke der Rüstung faktisch außer Kraft gesetzt. Das erinnert nicht nur an die Kriegskredite, die der Deutsche Reichstag 1914 bewilligte, es ist nichts anderes.
Für Geld ist daher gesorgt; wer es zurückzahlen soll, interessiert keinen. Das geht ja nur zu Lasten der Bevölkerung, an die man in Politikerkreisen keinen Gedanken verschwendet, außer um sie möglichst klein zu halten. „Das einfache Volk“, lässt Umberto Eco seinen Mönch William von Baskerville sagen, „war immer nur Schlachtvieh und Werkzeug, man bediente sich seiner, um die gegnerische Macht zu erschüttern, und man warf es fort, wenn man es nicht mehr brauchte.“ Denn genau dieses einfache Volk ist es, das nicht nur die unmäßig-ungeheuren Schulden tragen soll, sondern auch noch die Front besetzen darf: „Deutschland ist zurück aus dem Fronturlaub“, ich darf hier kurz an die FAZ erinnern. Stimmen zur Reaktivierung der Wehrpflicht hört man häufig, aber vor kurzem wurde ein neuer Schauplatz zur Rekrutenaushebung eröffnet, der noch nicht genug Beachtung gefunden hat.
Im Januar 2025 hat der Bundesgerichtshof, abgekürzt BGH, ein Urteil gefällt, das Anlass zu den schönsten Hoffnungen gibt. Ein ukrainischer Staatsbürger hatte in Deutschland den Kriegsdienst aus Gewissensgründen verweigert und ging davon aus, dass er deshalb nicht in die Ukraine, die seine Auslieferung verlangt hatte, überstellt würde, weil man dort das Recht auf Kriegsdienstverweigerung wegen des Krieges ausgesetzt hatte. Der BGH kam allerdings zu dem Ergebnis, dieser Umstand begründe „jedenfalls dann kein Auslieferungshindernis, wenn sein um Auslieferung ersuchendes Heimatland völkerrechtswidrig mit Waffengewalt angegriffen wird und ein Recht zur Kriegsdienstverweigerung deshalb nicht gewährleistet“. Der Ukrainer sei also auszuliefern.
Man könnte meinen, das sei ein sehr spezieller Fall, da es um einen den Kriegsdienst verweigernden Ukrainer und um ein Auslieferungsverfahren geht, was für deutsche Staatsbürger offenbar keine Relevanz habe. So einfach macht es der BGH aber auch den deutschen Wehrpflichtigen nicht. In der Begründung für ihren Beschluss haben die Richter nämlich immer wieder Hinweise auf ihre Einschätzung des deutschen Rechts auf Kriegsdienstverweigerung eingestreut, die seltsam anmuten. Man darf nicht vergessen: Es handelt sich dabei um ein Grundrecht, das bisher in seinem Kern nicht angetastet worden ist. In Artikel 4 des Grundgesetzes heißt es in Absatz 3: „Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.“ Es gab zwar einmal die seltsam anmutende Gewissensprüfung, doch es war unbestritten, dass das Recht auf Kriegsdienstverweigerung existiert und in Anspruch genommen werden kann. Jedoch scheint sich abzuzeichnen, dass auch für Artikel 4 das Harbarth-Prinzip angewendet werden soll: „Die Grundrechte gelten, aber sie gelten anders als vor der Krise“, meinte der Präsident des Bundesverfassungsgerichts im Verlauf der sonderbaren PCR-Pandemie, und öffnete damit dem Prinzip der Beliebigkeit und Willkür Tür und Tor.
Sehen wir also zu, was man am BGH in dieser Hinsicht zu bieten hat. Unter der Randnummer 30 des Beschlusses findet sich die Formulierung, auch unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Grundgesetzes gebiete „die deutsche verfassungsrechtliche Ordnung nicht die Annahme eines unüberwindbaren Auslieferungshindernisses für den Fall einer kriegsbedingten Aussetzung des Kriegsdienstverweigerungsrechts im Zielstaat“. Nun gut, das bezieht sich noch auf die Frage der Auslieferungsmöglichkeit. Aber gleich im nächsten Satz lesen wir: „Ein unabdingbarer Grundsatz der einschränkungslosen Aufrechterhaltung des Kriegsdienstverweigerungsrechts auch im Verteidigungsfall lässt sich ihr bereits auf nationaler Ebene nicht entnehmen.“
Das sieht nach einer deutlichen Anwendung des Harbarth-Prinzips aus. Die „deutsche Verfassungsrechtliche Ordnung“, die das Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen enthält, gebietet auf einmal nicht mehr die einschränkungslose „Aufrechterhaltung des Kriegsdienstverweigerungsrechts auch im Verteidigungsfall“. Und hier geht es um die „nationale Ebene“, nicht mehr um die Auslieferung eines ukrainischen Staatsbürgers. Aus dem klar formulierten Grundrecht lässt sich nach Auffassung des BGH nicht schließen, dass man im Verteidigungsfall den Kriegsdienst aus Gewissensgründen verweigern darf. Das ist allerdings, wenn man den ausgesprochen unwahrscheinlichen Fall eines von Deutschland geführten Angriffskrieges einmal ausnimmt, genau der Fall, in dem das Recht auf Kriegsdienstverweigerung zu seiner vollen Anwendung kommt: der Kriegsfall. Sollte es nur im Frieden gelten, hat es seinen Charakter und seinen Zweck verloren.
Doch das Gericht ist noch nicht am Ende seines Lateins. Unter der Randnummer 33 findet sich eine besonders schöne Argumentation. „Soweit der Verteidigungsfall mit einer Gefährdungslage nicht nur für die Landesverteidigung, sondern für die Grundrechtsverwirklichung eines jeden einhergeht, gilt dies indes ebenso für Schutzgehalte, die Art. 4 GG für zur Landesverteidigung berufene Wehrpflichtige gewährleistet. Daher erscheint es auch nach deutschem Verfassungsrecht nicht von vornherein undenkbar, dass Wehrpflichtige in außerordentlicher Lage zusätzlichen Einschränkungen unterliegen und in letzter Konsequenz sogar gehindert sein könnten, den Kriegsdienst an der Waffe aus Gewissensgründen zu verweigern.“
Was wollen uns diese Worte sagen? Im Verteidigungsfall kann es zu Gefährdungen für die Grundrechtsverwirklichung kommen, was auch für die „Schutzgehalte“ nach Artikel 4 gilt. Und deshalb ist es nicht undenkbar, dass man daran gehindert werden kann, den Kriegsdienst an der Waffe zu verweigern. Um das Grundrecht nach Artikel 4 nicht durch einen Angreifer gefährden zu lassen, ist es also möglich, es gleich auszusetzen. Ich bin beeindruckt.
Unter Randnummer 36 räumt man zwar ein: „Das Grundrecht der Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen setzt hiernach der verfassungsrechtlich verankerten Pflicht, sich an der bewaffneten Landesverteidigung und damit insoweit an der Sicherung der staatlichen Existenz zu beteiligen, eine „unüberwindliche“ Schranke entgegen.“ Doch gleich in der nächsten Nummer wollen das die Richter nicht mehr so ganz wahrhaben: Das Bundesverfassungsgericht habe mehrfach darauf hingewiesen, „dass der Vorrang, den der Schutz des freien Gewissens nach der deutschen verfassungsrechtlichen Ordnung selbst in ernsten Konfliktlagen erfährt, im Vergleich mit anderen demokratisch-rechtsstaatlichen Verfassungen bemerkenswert weit geht“. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Das deutsche Grundgesetz achtet die freie Entscheidung des Bürgers stärker als andere Verfassungen! Es liegt nahe, dass man dagegen etwas tun muss.
Die Antwort folgt auf dem Fuße, genauer gesagt unter Nummer 38. „Explizit offengelassen … hat das Bundesverfassungsgericht zudem, ob selbst jemand, der an sich zur Kriegsdienstverweigerung berechtigt erscheint, durch überragende Treuepflichten in außerordentlicher Lage gehindert sein kann, das Grundrecht geltend zu machen.“ Überragende Treuepflichten in außerordentlicher Lage – eine herrliche Formulierung, die sich auf alles und jedes anwenden lässt, denn wann eine solche Treuepflicht vorliegt, wird im Ernstfall natürlich nicht der Einzelne entscheiden, sondern der Staat. Tatsächlich hat das Bundesverfassungsgericht diese Wendung ein einziges Mal verwendet, und das war 1960. Aber was soll’s, die Argumentationsfigur ist seither in der Welt, und wenn es darum geht, ein Grundrecht zu vernichten, ist jedes Mittel recht.
Im Übrigen, so sieht man es beim BGH, entspreche es „ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass … die Einrichtung und Funktionsfähigkeit der Streitkräfte gegen das Interesse des Kriegsdienstverweigerers an der Freiheit von jeglichem Zwang gegenüber seiner Gewissensentscheidung abzuwägen sind“. Das Grundrecht aus Kriegsdienstverweigerung muss gegen die Funktionsfähigkeit der Streitkräfte abgewogen werden, wieder eine etwas eigenwillige Interpretation. Ich darf an das Harbarth-Prinzip erinnern: „Die Grundrechte gelten, aber sie gelten anders als vor der Krise“, und Krise herrscht heutzutage schließlich immer.
Von besonderer Schönheit ist aber der Schluss von Randnummer 38. Zunächst berufen sich die Richter auf das Prinzip, „dass miteinander kollidierende Grundrechtspositionen darüber hinaus in ihrer Wechselwirkung zu erfassen und nach dem Grundsatz der praktischen Konkordanz so in Ausgleich zu bringen sind, dass sie für alle Beteiligten möglichst weitgehend wirksam werden“. Hier kollidieren allerdings nicht so sehr viele Grundrechtspositionen, sondern es soll nur eine ruiniert werden, damit man genügend Wehrpflichtige für die Front findet. Zudem bleibt etwas unklar, wie das Grundrecht des Wehrpflichtigen auf Kriegsdienstverweigerung „möglichst weitgehend wirksam werden“ soll, indem man es ihm entzieht.
Schließlich kommt man zu dem Ergebnis: „Angesichts dessen erachtet es der Senat für – jedenfalls prinzipiell – nicht undenkbar, dass ungeachtet des besonders hohen Rangs der in Art. 4 GG verbürgten Gewissensfreiheit auch die deutsche verfassungsrechtliche Ordnung es gestatten oder sogar erfordern könnte, den Schutz des Kriegsdienstverweigerungsrechts in außerordentlicher Lage gegenüber anderen hochrangigen Verfassungswerten zurücktreten zu lassen.“ Es könnte also nicht nur gestattet, sondern sogar geboten sein, das Grundrecht nach Artikel 4 „zurücktreten zu lassen“ – was nichts anderes bedeutet als: es abzuschaffen – weil andere „hochrangige Verfassungswerte“ es erfordern. Und solange man ein Bundesverfassungsgericht und einen Bundesgerichtshof hat, die genau das tun, was von ihnen erwartet wird, steht außer Frage, dass sich solche hochrangigen Verfassungswerte immer leicht finden lassen. Gesteht man das einmal zu, hat man alles zugestanden. Immerhin gibt es auch noch andere Grundrechte außer dem auf Kriegsdienstverweigerung, und auch die lassen sich nach der vorgebrachten Methode durch Verweis auf „hochrangige Verfassungswerte“ leicht außer Kraft setzen. Das nenne ich Gründlichkeit.
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, resümiert das Gericht seine Auffassung unter der Randnummer 50. „Wie gesehen, sind Grundrechtsverkürzungen im Verteidigungsfall aber auch der deutschen verfassungsrechtlichen Ordnung selbst – auch in Bezug auf die Gewissensfreiheit – nicht fremd, sondern in ihr angelegt. Dabei erscheinen sogar weitergehende verfassungsimmanente Einschränkungen des Kriegsdienstverweigerungsrechts bis hin zu dessen Aussetzung in existenziellen Krisen des Staates prinzipiell nicht undenkbar.“ Sieh an! Grundrechtsverkürzungen sind in der verfassungsrechtlichen Ordnung sogar „angelegt“, es gehört sich also, die Grundrechte des Grundgesetzes niederzumachen. Und deshalb ist die Aussetzung des Kriegsdienstverweigerungsrechtes „in existenziellen Krisen“ rechtlich denkbar. Ich wiederhole: Was dem einen Grundrechtsartikel recht ist, ist dem anderen billig. Mit diesem Argument – wenn man es denn so bezeichnen will – kann jedes Grundrecht ausgehebelt werden, denn „existentielle Krisen“ lassen sich leicht herstellen; wir haben es während der sonderbaren PCR-Pandemie gesehen und sehen es noch heute im Zuge der vermeintlichen Klimakrise.
Kurz zusammengefasst: Wir sehen hier nicht nur einen viel versprechenden Ansatz zur Aushebelung des Grundrechts auf Kriegsdienstverweigerung vor uns, damit für den Krieg, dem derzeit zu viele entgegen hecheln, hinreichend viel Kanonenfutter vorhanden ist. Gleichzeitig hat man auch eine Vorlage entwickelt zum Aussetzen eines jeden beliebigen Grundrechts, sofern man sich nur eine existentielle Krise ausdenkt und sie den Menschen in möglichst düsteren Farben ausmalt. Dass so etwas funktioniert, haben wir erlebt.
„Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet“, schrieb der ebenso berühmte wie berüchtigte Jurist und Philosoph Carl Schmitt. Heute nennt man es nicht mehr Ausnahmezustand, sondern existentielle Krise.
Die Folgen sind die gleichen.
Gastbeiträge geben immer die Meinung des Autors wieder, nicht meine. Ich schätze meine Leser als erwachsene Menschen und will ihnen unterschiedliche Blickwinkel bieten, damit sie sich selbst eine Meinung bilden können.
ES GEHT NUR MIT IHRER UNTERSTÜTZUNG
Im Dezember 2019 ging meine Seite an den Start. Heute erreicht sie bis zu 53,7 Millionen Aufrufe im Monat. Sie setzt Themen, die selbst große Medien nicht mehr ignorieren können.
Mein Ziel:
Kritisch, unabhängig und furchtlos der Regierung und ihren Hofberichterstattern auf die Finger schauen – ohne Steuergelder, ohne Großspender, nur mit Herzblut, Idealismus – und vor allem: mit Ihrer Hilfe.
Ihre Unterstützung macht meinen Einsatz überhaupt erst möglich. Jede Geste, ob klein oder groß, zeigt mir: Mein Engagement – mit all den Herausforderungen und schlaflosen Nächten – wird geschätzt.
Das ist für mich nicht nur ein unermesslich wertvolles Geschenk, sondern auch eine große Motivation, weiterzumachen.
Von Herzen: Danke!
Der einfachste und billigste Weg, ohne jede Abzüge, ist eine Banküberweisung:
IBAN: DE30 6805 1207 0000 3701 71.
Alternativ sind (wieder) Zuwendungen via Kreditkarte, Apple Pay etc. möglich – allerdings werden dabei Gebühren fällig.
Über diesen LinkMit noch höheren Gebühren ist über Umwege auch (wieder) Paypal-Bezahlung möglich:
Über diesen LinkBITCOIN-Empfängerschlüssel auf Anfrage
Diejenigen, die selbst wenig haben, bitte ich ausdrücklich darum, das Wenige zu behalten. Umso mehr freut mich Unterstützung von allen, denen sie nicht weh tut.
Merz & SPD hebeln Wählerwillen aus – der dreiste Coup gegen die Demokratie!
Mannheim: Amokfahrt mit Ansage? Was verschweigt man uns diesmal– und warum hören wir immer dasselbe?
Warum gewinnt Rot-Grün in Hamburg, obwohl es krachend gescheitert ist? Die unbequeme Wahrheit
Thomas Rießinger ist promovierter Mathematiker und war Professor für Mathematik und Informatik an der Fachhochschule Frankfurt am Main. Neben einigen Fachbüchern über Mathematik hat er auch Aufsätze zur Philosophie und Geschichte sowie ein Buch zur Unterhaltungsmathematik publiziert.
Bild: Ryan Nash Photography / Shutterstock.comBitte beachten Sie die aktualisierten Kommentar-Regeln – nachzulesen hier. Insbesondere bitte ich darum, sachlich und zum jeweiligen Thema zu schreiben, und die Kommentarfunktion nicht für Pöbeleien gegen die Kommentar-Regeln zu missbrauchen. Solche Kommentare müssen wir leider löschen – um die Kommentarfunktion für die 99,9 Prozent konstruktiven Kommentatoren offen zu halten.
Mehr von Thomas Rießinger auf reitschuster.de