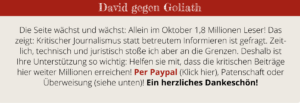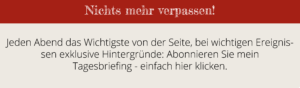Ein Gastbeitrag von Alexander Fritsch
Donald Trump hat verloren, kein Gerichtsverfahren wird daran etwas ändern. Man mag jetzt rätseln oder sich auch darüber aufregen, wie das passieren konnte. Womöglich spannender ist die Frage, was der 45. Präsident der USA hinterlässt. Spoileralarm: Es ist viel mehr, als die meisten glauben.
„Wenn ich den Eindruck hätte, dass in dem, was Sie da sagen, auch nur ein Körnchen Vernunft steckt, würde ich mir vielleicht die Mühe machen, mich auf eine solche Diskussion einzulassen. Aber wie die Dinge liegen, werde ich einfach an etwas anderes denken, während Sie weiter vor sich hin plappern.“
(Kazuo Ishiguro – „Was vom Tage übrig blieb“)
Donald Trump ist der erste US-Präsident seit 40 Jahren, der keine einzige neue Militäroperation befohlen – geschweige denn, einen Krieg angefangen hat.
Nur so zum Vergleich: Friedensnobelpreisträger Barack Obama hatte in acht Jahren sieben Mal (in Zahlen: 7x) sozusagen auf den Knopf gedrückt und Truppen losgeschickt. Vier (4) dieser Engagements dauern immer noch an (Stand: 10. November 2020, 20.00 Uhr).
Erinnert sich noch jemand daran, wie Donald Trump nach seinem überraschenden Wahlsieg 2016 von den üblichen Verdächtigen links der Rationalität als Kriegstreiber gezeichnet wurde, der wohl die Welt in Schutt und Asche legen werde? Das war schon damals eine recht alberne „Analyse“, die erkennbar wenig über Trump aussagte – dafür umso mehr über ihre Urheber und deren offenkundige Unkenntnis politischer Strategien im Allgemeinen und der USA im Besonderen.
Anders als die „Journaktivisten“ (Don Alphonso) diesseits und jenseits des Atlantiks gerne fabulieren, hatte Trump eine ziemlich ausgeklügelte politische Strategie – die man aber natürlich nicht erkennen konnte, wenn man so viel Schaum vor dem Mund hatte, dass gar kein Sichtfeld mehr übrigblieb.
Mit dieser Strategie hat Trump in seinen vier Amtsjahren die USA ordentlich durchgerüttelt. Er wird tiefe und lange nachwirkende Spuren hinterlassen – vor allem auf diesen Gebieten:
1.) Trump und die gesellschaftlichen Koalitionen
Barack Obama war es 2008 gelungen, erstmals in der US-Geschichte erfolgreich ein Bündnis aus Menschen zu schmieden, die benachteiligt sind oder sich zumindest dafür halten: bestimmte Frauen, bestimmte Afroamerikaner, bestimmte Latinos und so weiter. Entgegen dem historischen Credo des „American Dream“, dass jeder für sein Schicksal, sein Glück und seinen Lebenserfolg selbst verantwortlich ist, zimmerte Obama eine Regenbogenkoalition aus Leuten, die einen Anspruch an den amerikanischen Staat zu haben meinten.
Das war neu, es war im Prinzip unamerikanisch, aber es war erfolgreich. Donald Trump brachte 2016 dann drei quer dazu geschnittene Gruppen zusammen:
Erstens – die Isolationisten. Sie gibt es traditionell in beiden großen Parteien und in allen Bevölkerungsschichten. In den Jahrzehnten vor Trump waren sie im amerikanischen Politikbetrieb sukzessive an den Rand gedrängt worden. Der Regensburger Politikwissenschaftler und USA-Experte Stephan Bierling hat aber zurecht darauf hingewiesen, dass sie immer entscheidend blieben: Nach dem Zweiten Weltkrieg hat bei US-Präsidentschaftswahlen eigentlich ausnahmslos der Kandidat mit dem quasi isolationistischeren Programm gewonnen. Das galt auch für Obama 2008 im Duell mit John McCain – erst recht galt es für Trump 2016 im Duell mit Hillary Clinton.
Trump ist bekannt dafür, dass er seine Basis pflegt und politisch bedient – indem er einfach das tut, was sie von ihm erwartet. Entsprechend waren der Rückzug der USA aus internationalen Verpflichtungen und der Verzicht auf neue militärische Engagements keineswegs zufällig.
Zweitens – die christlichen Fundamentalisten. Auch sie sind eine traditionelle und große Gruppe in den USA. Ursprünglich waren sie sogar stärker bei den Demokraten verwurzelt – der aktive Baptist Jimmy Carter bezeichnete sich selbst als „wiedergeborenen Christen“. Die Entwicklung der Partei vertrieb die Religiösen allmählich.
Trump aktivierte dieses große Wählerpotenzial für die Republikaner mit dem Versprechen, das religiöse Anliegen zu schützen. Vor allem sagte er zu, die von den christlichen Fundamentalisten empfundene kulturelle Entmachtung mithilfe der Gerichte zu stoppen und offene Richterstellen entsprechend zu besetzen.
So erklärt sich auch, dass die Religiösen dem mehrfach verheirateten Trump – einem offenkundig gar nicht religiösen notorischen Ehebrecher – eisern die Treue hielten.
Drittens – die Globalisierungsverlierer. „Ich liebe ungebildete Leute“, rief Trump auf einer Wahlkampfveranstaltung 2016 in Las Vegas der jubelnden Menge zu. Damit bekannte er sich – auch kulturell – zu eben jenen Wählern, die dann Hillary Clinton als „kläglich“ bezeichnen sollte.
Clinton wirkte dabei arrogant, hochmütig und herablassend – und war auch genau das. Sie offenbarte damit aber nur, wie sehr sich die Demokratische Partei unter Obama von den unteren Einkommensschichten, von den Industriearbeitern und den ungelernten Hilfskräften entfremdet hatte.
Dabei ging und geht es interessanterweise weniger um Materielles als vielmehr um Achtung und Respekt. Ökonomisch hat Trump die Lage dieser soziologischen Schicht kaum verbessert. Aber es gelang ihm, mindestens den Eindruck zu vermitteln, diese Wähler ernst zu nehmen – anders als die restliche „Elite“ in Washington, die zwar immer vom kleinen Mann redet, ihn dann aber letztlich doch hochnäsig ignoriert.
Vor allem in Deutschland wird konsequent übersehen, dass nicht wenige US-Industriegewerkschaften von Trumps protektionistischer Politik geradezu begeistert waren. Übrigens: Das „republikanische“ Florida stimmte gerade FÜR eine Erhöhung des Mindestlohns. Das „demokratische“ Kalifornien stimmte gerade GEGEN einen besseren sozialen Schutz von Uber-Fahrern.

Es sieht derzeit also nicht so aus, als hätten die Demokraten ihre Lektion wirklich gelernt.
2.) Trump und die politischen Institutionen
Donald Trump ist ein Spezialist für Konflikte.
Das ist weder ein Lob noch eine Kritik, es ist erst einmal nur eine Feststellung. Jeder Politiker versucht, die Entscheidung auf das Spielfeld zu verlagern, auf dem er für sich die größten Chancen sieht. Entsprechend ist Trumps bevorzugtes Spielfeld der Streit.
Die Polarisierung der politischen Institutionen ist weder eine Trump‘sche Erfindung noch das Ergebnis seines Handelns. Trump hat nur – anders als viele Vorgänger – diese Polarisierung als für sich vorteilhaft identifiziert. Folgerichtig hat er nicht versucht, Konflikte in Kompromissen aufzulösen. Stattdessen hat er Konflikte geschürt, um sie zu gewinnen.
Im Parteienspektrum haben die Demokraten ihm den Gefallen getan, dabei mitzuspielen. Und obwohl das bei der Präsidentschaftswahl 2020 jetzt beinahe epochal schiefgegangen wäre, wollen einige Demokraten Trump bei der Polarisierung offenbar noch überbieten.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Alexandria Ocasio-Cortez ist für die US-Politik so ein bisschen das, was Sarah Wagenknecht in Deutschland war: die linkeste Lautsprecherin von allen. Angemessen simpel ist ihre Argumentation: Wer gegen „Defund“ (die Mittelkürzung für die Polizei) und/oder gegen Sozialismus ist, muss ein Rassist sein.
Das ist noch holzschnittartiger, als man es von den Trump-Tweets gewöhnt war. Und es bietet einen Vorgeschmack darauf, wie der große ultra-linke Flügel der Demokraten den neu gewählten, durchaus eher gemäßigten Präsidenten Joe Biden vor sich hertreiben dürfte.
Wegen dieser ungebremsten (und durch seinen eigenen Wahlerfolg sogar noch befeuerten) Radikalisierung seiner Partei wird Biden Konzessionen machen müssen. Die dürften kaum wirtschaftspolitisch sein – zu genau wissen die regierenden Demokraten in den von ihnen gehaltenen Bundesstaaten, dass man damit die eben gerade erst zurückgewonnenen Wählerschichten sofort wieder vergraulen würde.
Biden dürfte also den Radikalen in seiner Partei auf anderen Gebieten entgegenkommen: auf jenen, die den linken Identitätspolitikern wichtig sind – zum Beispiel bei der Zuwanderung. Das aber ist gerade das politische Gebiet, auf dem man am schnellsten und leichtesten eine weitere Radikalisierung der Republikaner herbeiführen kann und wird.
Die Polarisierung der politischen Parteien in den USA wird also sehr vermutlich nach Donald Trump nicht nur weitergehen, sondern sich sogar verschärfen.
Noch mehr als in den beiden großen Parteien wird Donald Trump an den Gerichten nachwirken.
Die Ernennung von Richtern ist in der amerikanischen Verfassung geregelt. Sie werden vom Präsidenten nominiert und danach vom Senat bestätigt. 1.062 Oberste-, Bundes- und Berufungsrichter gibt es in den USA. Sagenhafte 274 davon hat Trump in seinen vier Jahren im Weißen Haus berufen – mehr als jeder andere in den vergangenen 40 Jahren. Es sind überwiegend junge, weiße Männer. Aber alle, auch die Frauen, sind vor allem eines: konservativ.
Die Langzeitwirkung dieses Phänomens wird zwar immer wieder angedeutet, aber trotzdem immer noch unterschätzt. Um die Zeiträume zu verdeutlichen, in denen die US-Justiz hier geprägt wird, hilft vielleicht ein vom Politologen und USA-Experten Philipp Adorf dokumentiertes Beispiel:
Der nach allgemeinem Urteil mit Abstand konservativste Richter am Obersten Gerichtshof der USA, Clarence Thomas, wurde 1991 von Präsident George Bush nominiert. Sein Vorgänger, Thurgood Marshall, war 1967 (!) von Präsident John F. Kennedy (!!) nominiert worden. Kein Schreibfehler: Bis heute sitzt am Obersten Gerichtshof der USA also ein Richter, dessen unmittelbarer Vorgänger noch unter JFK ins Amt kam.
Das sind die Zeiträume, in denen Donald Trump nachwirken wird.
3.) Trump und die politische Kommunikation
Neusprech ist tot.
Jedenfalls in den USA (für Deutschland muss man da wohl weniger zuversichtlich sein). Die typische, alltags- und volksferne Formelsprache der Berufspolitiker wurde von Donald Trump diskreditiert und dekonstruiert.
Wie erfolgreich er dabei war, zeigt sich vor allem in der Reaktion des selbsterklärten Mainstreams. „Nicht präsidial“ sei der Präsident, lässt sich die Empörung zusammenfassen. Die Historikerin Jessica Gienow-Hecht vom John-F.-Kennedy-Institut in Berlin hat diesen Anti-Trump-Routinereflex wohltuend nüchtern relativiert:
Vielleicht, gibt sie zu bedenken, sei die bisher vorherrschende politische Kommunikation eben auch nur ein Zeitgeist-Phänomen. Vielleicht sei Trumps Stil deshalb so erfolgreich, weil sich die althergebrachten Muster der politischen Kommunikation überholt hätten und das Publikum zunehmend nach einer anderen Ansprache verlange.

Vielleicht ist es kein Zufall, dass – siehe oben – gerade auch linke Demokraten z. B. auf Twitter zunehmend so auftreten wie kleine Donald Trumps.
Das mutmaßlich nachhaltigste Schlüsselwort der vier Trump-Jahre ist: Authentizität.
Trump hat seit 2016 im Weißen Haus ziemlich genau das getan, was er im Wahlkampf davor angekündigt hatte. Das, was er getan hat, muss man nicht mögen. Man kann dem Mann viel vorwerfen, wenn man will. Was man ihm aber nicht vorwerfen kann, ist Wählertäuschung.
An die hatten wir uns in den vergangenen Jahrzehnten bei unseren Berufspolitikern offenbar so gewöhnt, dass wir es gar nicht mehr gemerkt haben, wenn einer nach der Wahl tatsächlich das tut, was er vor der Wahl angekündigt hat.
Trump hat nie behauptet, Präsident aller Amerikaner sein zu wollen. Trump hat nie behauptet, das Land einen zu wollen. Trump hat nie behauptet, „normale“ Politik machen zu wollen. Trump hat noch nicht einmal behauptet, die Wahrheit zu sagen.

Im September 2016 gab es einen denkwürdigen Moment: Der USA-Korrespondent eines deutschen öffentlich-rechtlichen Senders (Quelle liegt vor, wird aus Pietät hier aber nicht genannt) befragte eine Amerikanerin am Rande einer Trump-Wahlkampfveranstaltung. „Glauben Sie denn wirklich, dass Trump die Wahrheit sagt?“, fragte der Journalist.
„Natürlich nicht“, sagte die Amerikanerin abgeklärt. „Er ist Politiker. Die lügen alle.“ Und dann sagte sie diesen einen Satz:
„Aber zumindest tut er nicht so, als würde er die Wahrheit sagen.“
 Alexander Fritsch, Jahrgang 1966, studierte Volkswirtschaft und Philosophie in Frankreich und Deutschland und arbeitet seit 25 Jahren als Journalist. Außerdem berät er als Business Coach Unternehmen und Verbände, vorrangig bei den Themen Kommunikation und Strategie.
Alexander Fritsch, Jahrgang 1966, studierte Volkswirtschaft und Philosophie in Frankreich und Deutschland und arbeitet seit 25 Jahren als Journalist. Außerdem berät er als Business Coach Unternehmen und Verbände, vorrangig bei den Themen Kommunikation und Strategie.