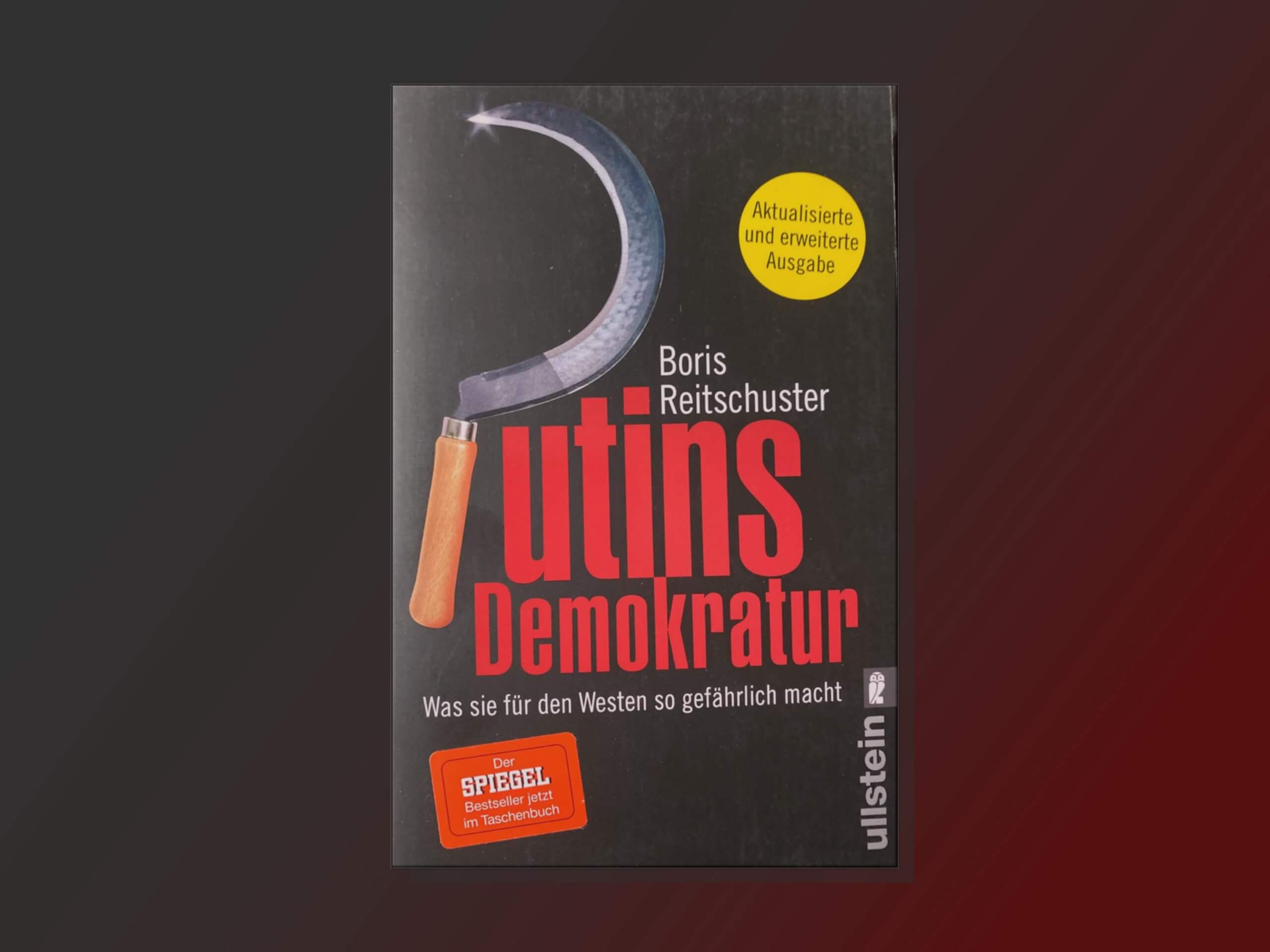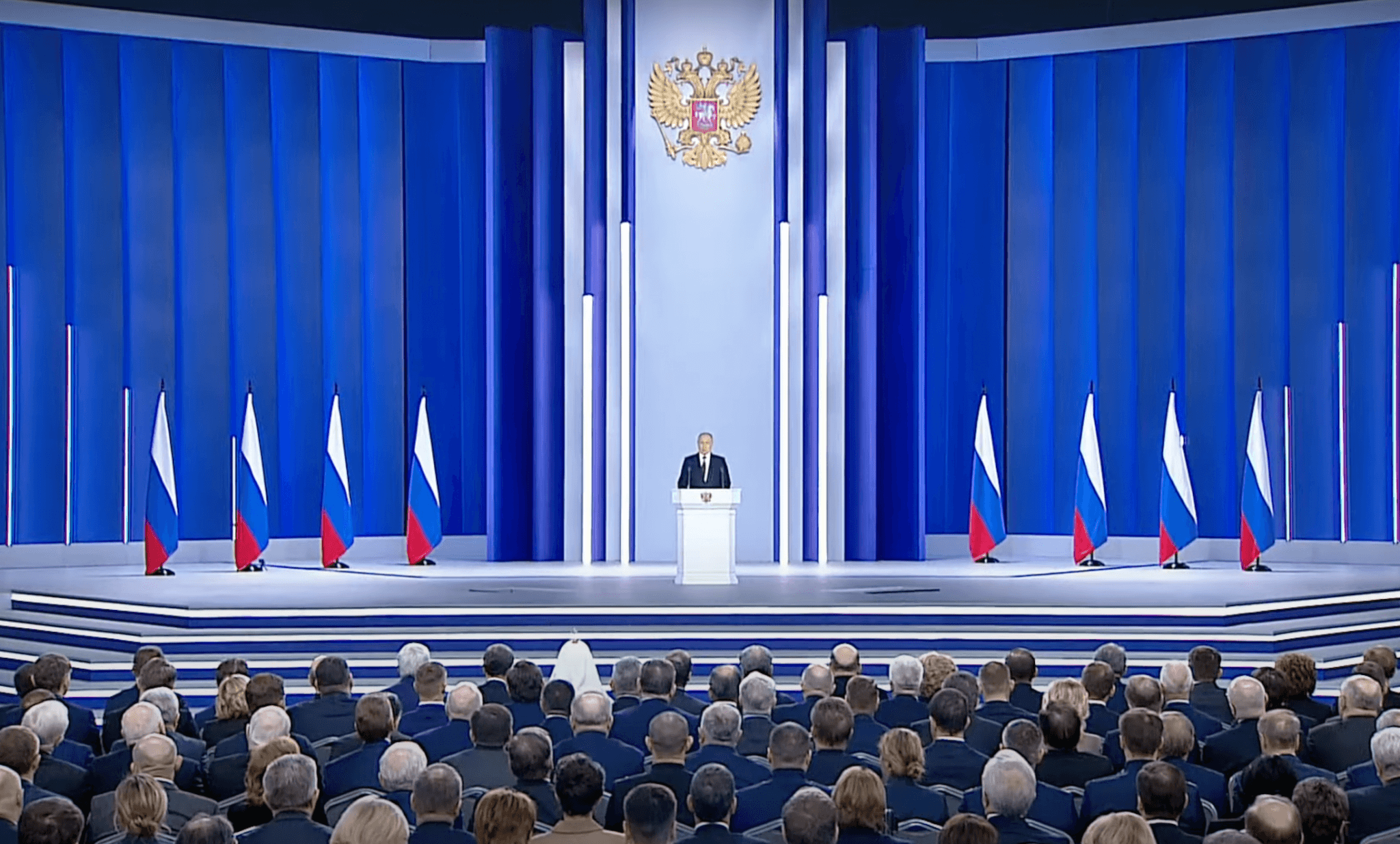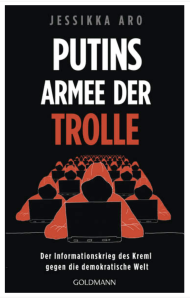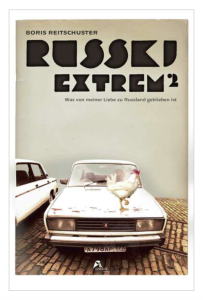Lesen Sie heute Teil 20 von „Putins Demokratur“. Warum ich Buch hier auf meiner Seite veröffentliche, können Sie hier in meiner Einleitung zum ersten Beitrag finden.
Der Feind lauert überall, auch in den eigenen Reihen. Man muss auf der Hut sein. Patrioten wie Wadim Retschkalow lassen sich nichts ins Bockshorn jagen. Der Journalist bei der Boulevard-Zeitung Moskowski Komsomolez hat einen besonderen Fall von Feigheit vor dem Feind aufgedeckt. Um dem Dienst am Vaterland zu entgehen, hat ein junger Wehrpflichtiger Hand an sich selbst angelegt, schreibt Retschkalow. Der Übeltäter war schon als Kind ein schwacher Junge. Kein Wunder, wuchs er doch – das Igitt ist zwischen den Zeilen herauszulesen – unter Mädchen auf. Mitten in der Nacht, so vermutet der Journalist und teilt diese Vermutung mit hunderttausenden Lesern, habe sich der Wehrpflichtige Andrej Sytschow mit einer Spritze Dieseltreibstoff in die eigenen Beine gespritzt. Liest man den Artikel mit der Überschrift »Wenn du Glück hast, kommst du ohne Beine zurück nach Hause«, bekommt man Mitleid mit den armen Militärs, die nun für den Selbstverstümmler leiden müssen, weil ihnen die Schuld an seinen Verletzungen angehängt wird. Der Militärstaatsanwalt in der Garnison in Tscheljabinsk im Ural sah die Sache ähnlich: Der 19-Jährige habe sich die Füße abgebunden, um sich um den Dienst zu drücken, erzählte ein Ermittler der entsetzten Mutter am 8. Januar 2006, als sie ihren nun fußamputierten Sohn im Krankenhaus besuchte.
Grausame Wahrheiten und das Versagen der Militärführung
Doch der Fall Sytschow nimmt einen ungewöhnlichen Verlauf. Eine Medizinerin aus dem Krankenhaus, in dem der junge Mann behandelt wird, ist so entsetzt über das, was sie sieht, dass sie sich über die Anweisung des Militärs, zu schweigen und sogar die Krankengeschichte geheim zu halten, hinwegsetzt. Sie ruft anonym die »Soldatenmütter« an – ein Verein, der als Reaktion auf den Tschetschenien-Krieg gegründet wurde und sich heute mit Unrecht in der Armee auseinandersetzt. »Bei uns liegt ein junger Soldat ohne Füße, alle im Krankenhaus weinen, wenn sie ihn sehen, wir können nicht zulassen, dass der Fall vertuscht wird.« Nun kommt eine ganz andere Version an den Tag: Dass besoffene Kameraden den attraktiven jungen Mann mit dem breiten Lächeln gemeinsam mit anderen »Frischlingen« in der Neujahrsnacht und danach tagelang verprügelt hätten. Dass sie Sytschow gezwungen hätten, drei Stunden lang in der Hocke zu sitzen, während sie mit den Füßen auf ihn eintraten. Sytschows Schwester sagt aus, seine Kameraden hätten ihn vier Stunden an einen Stuhl gefesselt und geprügelt. Eine Prozedur, die nach Ansicht der »Soldatenmütter« in der Armee durchaus üblich ist im Umgang mit Wehrpflichtigen, die erst vor kurzem eingezogen wurden. Nur waren im Falle Sytschow seine Peiniger offenbar so betrunken, dass sie die Fesseln derart festzurrten, dass die Blutzirkulation unterbrochen wurde.
Die Nachrichtenagentur Regnum berichtet unter Berufung auf Militärquellen, der 19-Jährige sei obendrein noch stundenlang an ein Bett gefesselt und vergewaltigt worden. Die Militärstaatsanwaltschaft müsse das aber auf Druck aus Moskau verschweigen, weil man um das Ansehen der Armee fürchte. Nach den Gewaltattacken hatte Sytschow riesige Schmerzen in den Beinen und im Unterleib. Tagelang verweigerten ihm die Vorgesetzten eine medizinische Behandlung. Erst als er am vierten Tag nicht mehr aufstehen konnte, kam er ins Lazarett. Es vergingen noch einmal zwei Tage, bis er auf die Intensivstation eines Krankenhauses verlegt wurde. Doch zu spät: Die Ärzte mussten dem angeblichen »Selbstverstümmler« beide Beine, eine Hand und die Genitalien amputieren. Eine schwere Blutvergiftung setzte Sytschow zu; wochenlang kämpften die Ärzte um sein Leben. Der Oberkommandierende der Landstreitkräfte, General Alexej Maslow, erklärt derweil im Fernsehsender RTR, die Eltern des Soldaten seien schuld an dessen Zustand: Sytschow sei nicht das Opfer von Gewalt, sondern einer Erbkrankheit.
Kaum ist der Fall Sytschow in den Schlagzeilen, da dringen fast täglich Nachrichten von weiteren Grausamkeiten in der Armee in die Öffentlichkeit. Ende Januar etwa quälten drei Soldaten einen jungen Kameraden in Ufa zu Tode. In dem Moskauer Krankenhaus, in dem Sytschow behandelt wird, liegt ein Soldat, den dienstältere Kameraden aus dem vierten Stock warfen, als er sich weigerte, ihnen Wodka zu besorgen. Ein anderer Patient stürzte beim Bau einer Datscha für seinen Vorgesetzten aus sieben Meter Höhe in die Tiefe. Im Fernen Osten mussten einem Soldaten nach Misshandlungen durch Kameraden beide Beine amputiert werden. Er hatte sich aus Angst vor weiteren Prügeln in Sommeruniform in einen kalten, feuchten Keller geflüchtet; dort fanden ihn nach 23 Tagen Handwerker, halb bewusstlos. Der Vorfall war sieben Monate geheim gehalten worden. Es wird bekannt, dass allein im Januar 2006 in der russischen Armee 53 Soldaten starben: Unter anderem 19 davon durch Unglücksfälle, 14 brachten sich selbst um, elf starben bei Verkehrsunfällen, sieben kamen durch »Verbrechen von Zivilisten« ums Leben und zwei wurden »Opfer von Unvorsichtigkeit«, wie das Verteidigungsministerium kryptisch mitteilt.
Unbedarfte Beobachter könnten zu dem Schluss kommen, in einer bislang friedlichen und zivilisierten Armee sei urplötzlich eine Welle der Gewalt ausgebrochen. Die Opposition glaubt an andere Gründe: Nachdem Verteidigungsminister Sergej Iwanow im November 2005 zum Vizepremier ernannt wurde und damit zum möglichen Putin-Nachfolger, war Iwanows Rivalen daran gelegen, am Ansehen ihres Gegners zu kratzen. Tatsächlich ist angesichts der gesteuerten Medienlandschaft andernfalls schwer zu erklären, warum plötzlich ein Fall von Misshandlung in der Armee für großes Aufsehen sorgt, statt als winzige Randnotiz aufzutauchen. Die ermittelnde Militärstaatsanwaltschaft unterstand Generalstaatsanwalt Ustinow, der mit Putins Vizepräsidialamtschef Setschin verschwägert ist – einem erbitterten Rivalen des Verteidigungsministers. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die Berichte über die Missstände in der Armee nach kurzer Zeit ebenso schnell und überraschend wieder von den Bildschirmen verschwinden, wie sie dort aufgetaucht sind: Vieles spricht dafür, dass man im Kreml erschrocken war angesichts der Fülle neuer Skandale in der Armee, die plötzlich an die Öffentlichkeit kamen, und dass man Angst vor einer offenen Diskussion über die Zustände beim Militär bekam.
Ehre versus Realität
Im Juni 2006 berichtet Sytschows Schwester, ein Unbekannter habe ihm am Krankenbett einen Deal angeboten: Gegen Zahlung von 100 000 Dollar sollte der junge Mann seine Anzeige zurückziehen und eine fertige Erklärung unterschreiben, wonach er bei seinen Aussagen unzurechnungsfähig war; in Wirklichkeit sei ihm nichts Böses widerfahren, und seine Leiden Folgen einer Krankheit. Sytschow lehnte den Deal empört ab.
Zur gleichen Zeit fordert Präsident Putin im Fernsehen alle jungen Männer auf, zur Armee zu gehen: »Jeder Bürger des Landes muss verstehen, dass es eine Ehrenpflicht ist, in der Armee zu dienen. Wir alle müssen begreifen, dass es ohne Armee kein Land gibt, dass niemand daran Zweifel hat. Wenn es keine Armee gibt, gibt es kein Russland!« Zeitungen berichten, dass Russlands neue Machtelite es trotz solcher Appelle vorzieht, ihre eigenen Kinder nicht zur Armee zu schicken: Die beiden Söhne von Verteidigungsminister Iwanow haben ebenso wenig gedient wie der Filius des Generalstabschefs.
In der Realität geht es in der Armee nicht immer so ehrenhaft zu wie in den Politikerreden, wie Oberstleutnant Oleg von seiner Spezialeinheit der Miliz aus Togliatti in der Zeit berichtet: »Wir sind auf der Hauptstraße nach Grosny beschossen worden. Als wir uns zurückziehen wollten, bekamen wir per Funk den Befehl, weiterzukämpfen, weil vorne noch ein hoher Offizier sei. Wir stoßen vor. Dabei war der Offizier weggelaufen und längst hinter uns. Als ich das höre, schicke ich einen Schützenpanzer nach vorne, um unsere Leute rauszuholen. Da schreit dieser Offizier mich an: ›Wir hauen jetzt mit Minen rein!‹ Ich rufe ihm zu. ›Da sind noch unsere Leute!‹ Und er antwortet: ›Ich pfeife drauf!‹«
In den Medien wird die Armee wieder glorifiziert. Das Verteidigungsministerium hat gar einen eigenen Fernsehsender gegründet. Die Hälfte der Russen hält die Armee für wichtiger als persönliche Rechte oder den Wohlstand im Land. Jeder Fünfte sieht die »Stärkung des kriegerischen Geistes« als ihre Aufgabe an; viele sehen in der Armee den Kern des Staates und eine unabdingbare »Schule fürs Leben«, die aus Jungen Männer mache. Gleichzeitig fürchten Mütter und Söhne im Land den Militärdienst mehr als alles andere. Aus Angst vor einer Einberufung ihrer Söhne beginnen viele russische Mütter bereits Atteste zu sammeln, wenn die Jungen noch im Kindergarten sind. Wer es sich irgendwie leisten kann, kauft sich mit Bestechungsgeldern vom Wehrdienst frei. Folglich sind es vor allem Kinder aus sozial schwachen Familien und der Provinz, die dienen; ein Fünftel hat nicht einmal die Schule abgeschlossen. Nach Zählungen der »Soldatenmütter« werden jährlich 3000 der mehr als eine Million Soldaten gefoltert und in den Tod getrieben. Diese Zahlen sind nicht zu belegen, doch auf der Website des Verteidigungsministeriums ist ebenso offiziell wie kommentarlos zu lesen, dass die russische Armee in den ersten acht Monaten des Jahres 2005 ohne Kämpfe 660 Soldaten verlor – mehr als die USA während der aktiven Kampfhandlungen im Irak. Die »Dedowschtschina« – wörtlich übersetzt die »Herrschaft der Opas«, also der länger Gedienten – terrorisiert die neu einberufenen Soldaten, missbraucht und demütigt sie systematisch. »Dahinter steckt ein System von Folterung, von Gewaltverbrechen, oft mit dem Ziel, Geld zu erpressen, und das machen nicht nur Wehrpflichtige, sondern auch Offiziere«, klagt Valentina Melnikowa, Vorsitzende der »Soldatenmütter« und eine Frau mit der Durchsetzungskraft eines Generals.
Politisches Gerangel
Verteidigungsminister Sergej Iwanow sieht das anders. Es gebe keine Krise beim Militär, sagt er nach dem Fall Sytschow vor der Duma, vor der er freiwillig erscheint, nachdem die Abgeordneten es abgelehnt haben, ihn vorzuladen. Schuld sei nicht die Armee, sondern die russische Gesellschaft mit ihrer »moralischen Pathologie«. Im Zivilleben seien junge Männer öfter in Unfälle verwickelt als beim Militär. Dass der Fall Sytschow aufgeblasen wurde, sei Schuld der Journalisten. Nach dieser Bemerkung trauen viele russische Medien sich tags darauf nicht einmal mehr, diesen Vorwurf zu zitieren. Wenn in den russischen Medien dazu aufgerufen werde, den Militärdienst zu umgehen, sei das Landesverrat, beklagt Iwanow: »Wir haben Tausende Briefe von Müttern erhalten, voll mit Worten des Dankes, dass wir ihre Söhne eingezogen haben, dass wir sie gefüttert und zu echten Männern gemacht haben.« Soldat Sytschow darf den Auftritt des Ministers im Fernsehen nicht mitverfolgen: Die Ärzte verbieten ihm alles, was ihn aufregen könnte.
Die Behörden werfen den »Soldatenmüttern« Wehrkraftzersetzung vor. Am 19. April 2006 bekommen sie einen Brief des Gerichts im Moskauer Basman-Bezirk, das so berüchtigt ist für seine willkürlichen und oft hanebüchenen Entscheidungen, dass Moskauer Oppositionelle bereits bitter von einer »Basman-Gerichtsbarkeit« sprechen und damit die Willkür der Justiz meinen. Dieses Basman-Gericht kündigt an, es werde auf Antrag des Bundesregisteramtes über eine Auflösung der »Soldatenmütter« verhandeln. Den Klageantrag legt das Gericht nicht bei, so dass Melnikowa nicht weiß, wogegen sie sich wehren soll. Wenig später zieht das Amt seine Klage zwar zurück, doch den »Soldatenmüttern« droht weiterhin ein Verbot: Ein neues, restriktives Gesetz schränkt seit dem 18. April 2006 die Arbeit humanitärer Organisationen stark ein; es ermöglicht den Behörden, sie strenger zu kontrollieren und zu schließen.
Dabei ist selbst ein restriktiver Staat auf kritische Organisationen angewiesen. So sind es ausgerechnet die »Soldatenmütter«, die einen wesentlichen Beitrag zu Wladimir Putins Prachtentfaltung und Sicherheit leisten. Die Offiziere der Kremlgarde fahren regelmäßig in die Provinz und wählen sich dort »gebildete, untadelige, groß gewachsene und slawisch aussehende Wehrpflichtige« aus und verpflichten die örtlichen Wehrersatzämter, diese nach Moskau zu schicken. Doch die Beamten spielen der Garde häufig einen bösen Streich und senden unter fadenscheinigen Vorwänden statt der Auserwählten einen wild zusammengewürfelten Haufen in den Kreml: Diejenigen, die am meisten Bakschisch für die begehrten Plätze zahlen – und bei »Tarifen« bis zu 1000 Dollar sind das oft gerade nicht die »Gebildeten und Untadeligen«. Auf Bitten der Gardeoffiziere kontrollieren jetzt die »Soldatenmütter« die Wehrbeamten in der Provinz und melden Verstöße.
Reformen, Korruption und der Schatten der Vergangenheit
Wenige Wochen nach der Sytschow-Affäre verkürzt das russische Parlament die Dauer des Wehrdienstes von zwei Jahren auf ein Jahr. Gleichzeitig schafft es aber auch eine Reihe Ausnahmen von der Wehrpflicht ab: Künftig müssen junge Männer auch dann zum Militär, wenn ihre Ehefrau im 7. Monat schwanger ist oder sie Kinder unter drei Jahren haben. Konnten Studenten bisher den Wehrdienst oft durch den Besuch von Militärstunden an der Uni umgehen, so soll diese Möglichkeit künftig eingeschränkt werden. Angesichts der enormen Korruption in der Wehrverwaltung besteht die Gefahr, dass die Neuregelung nicht zu mehr Wehrgerechtigkeit führt, sondern zu mehr Bestechungsfällen, weil mehr Wehrpflichtige versuchen werden, sich mit Bakschisch vom Wehrdienst freizukaufen. Gerade Studenten, die bisher vom Wehrdienst befreit waren, dürften für die Wehrbeamten eine zahlungskräftige neue »Kundschaft« sein.
Die soziale Lage der Armee ist kritisch. Die Hälfte der russischen Offiziere lebt unter der Armutsgrenze, 170 000 in schlechten Wohnverhältnissen. Der Ausrüstungsbestand ist 13-mal niedriger als in den USA und dreimal niedriger als in China. Nach wie vor ist die Kriminalitätsrate in den Streitkräften hoch. In Tschetschenien verkaufen russische Militärs, die oft monatelang ihre Frontzulagen nicht erhalten, Waffen an den Feind, mit denen dann russische Soldaten getötet werden. Der Diebstahl von Benzin und Diesel ist weit verbreitet. Junge, fähige Offiziere sind ebenso wie Wehrpflichtige ständigen Erniedrigungen ausgesetzt. Allein im Jahr 2005 verließen 12 000 junge Offiziere die Armee. Oft gehen die fähigsten Köpfe. Zurück bleibt, wer keine andere Arbeit findet. Generalstaatsanwalt Ustinow spottete, man könne aus den Offizieren, die im vergangenen Jahr ein Verbrechen begangen hätten, zwei Regimenter bilden. Gegen 16 000 Militärs kam es zu einer Anklage.
An der Technik nagt der Rost. Das Gefahrenpotential der Flotte liegt vor allem in sinkenden U-Booten. Von den 22 000 Panzern müssten 9000 generalüberholt werden. Die Modernisierung der SU-27-Jagdflieger wird bei dem derzeitigen Tempo vierzig Jahre dauern. Die Rüstungsbetriebe produzieren vor allem fürs Ausland, etwa China. Bis auf wenige High-Tech-Produkte läuft allerdings hauptsächlich alte Sowjetware mit leichter Fassadenkosmetik vom Band. Die Piloten kommen seit Jahren nicht mehr auf die vorgeschriebenen Flugstunden, die Matrosen nicht auf die nötigen Seefahrten, weshalb sie weder auf den Ernstfall noch auf ernste Manöver ausreichend vorbereitet sind.
Bei den Hütern von Russlands atomarem Potential kommt es schon mal zu Schlägereien im Suff. Dennoch dienen bei den Atomstreitkräften die am besten ausgebildeten Offiziere der Armee. Auch die automatischen Sicherheitssysteme sind zuverlässig, wie selbst amerikanische Analysen bescheinigen.
Schlendrian gibt es jedoch zumindest in der Buchführung. Als der ukrainische Parlamentsabgeordnete Serhij Sintschenko die Leitung in einem Untersuchungsausschuss übernimmt, der die Übergabe ukrainischer Atomwaffen an Russland Anfang der neunziger Jahre kontrollieren soll, glaubt er seinen Augen nicht zu trauen, als er sich in die Unterlagen einarbeitet. Danach waren Atomsprengköpfe einfach verschwunden, wie er im April 2006 berichtet: »Nach unseren Untersuchungen kamen 250 Einheiten weniger in Russland an, als wir dorthin geliefert hatten.« Es gebe allerdings keine Anhaltspunkte dafür, dass die Waffen in die Hände Dritter gelangt sein könnten, etwa in den Iran, betont Sintschenko. »Ich bin überzeugt, dass die Sprengköpfe nur auf dem Papier fehlen, dass es sich lediglich um Schlamperei bei der Buchführung handelt und dass die Sprengköpfe nicht wirklich verlorengegangen sind.« Die Entdeckung des Abgeordneten spricht nicht für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Kernwaffen. »Die Buchführung war unprofessionell. Offenbar hielt es niemand für nötig nachzuzählen. Als ich das erfuhr, war ich bestürzt. Jede Geflügelfarm zählt ihre Hühner genauer ab, obwohl das schwieriger ist, aber hier handelte es sich um Atomwaffen«, klagt der Abgeordnete. Die Unterlagen gehen an die Staatsanwaltschaft. Russische Militärs weisen die Aussagen des Ukrainers als »Unsinn« zurück.
Vor Reformen schreckt die sowjetisch geprägte Armeeführung indes zurück. Der Aufbau einer modernen, gegen Terrorgefahren gerichteten Armee würde den bürokratischen Wasserkopf eliminieren und damit vielen Generälen die Schulterklappen kosten. Wenn sich Wladimir Putin mit der Generalität trifft, gibt es meist mehr Orden als kritische Worte.
Rüstungswettlauf und innenpolitische Unsicherheiten
Seit Jahren verspricht Putin eine Rückkehr Russlands zu militärischer Macht. »Es ist zu früh, von einem Ende des Wettrüstens zu reden. Vielmehr dreht sich das Schwungrad immer schneller«, warnte der Präsident und kündigte Investitionen in neue Waffensysteme an: »Je stärker unser Militär ist, umso geringer wird die Versuchung sein, Druck auf uns auszuüben.« Tatsächlich hat Putin in seinen ersten beiden Amtszeiten die Ausgaben für Verteidigung innerhalb von fünf Jahren auf 25 Milliarden Dollar verfünffacht. Mitte der 2000er Jahre erhielten Heer und Luftwaffe erstmals im größeren Umfang modernen Ersatz für veraltete sowjetische Ausrüstung. Die Modernisierung der Atomstreitkräfte indes stockt, weil die Preise für neue Raketen fast genauso schnell steigen wie der Verteidigungsetat. Dabei haben viele der alten SS-20-Raketen schon das Zweifache ihrer vorgesehenen Einsatzzeit hinter sich und sind laut Experten für die eigene Truppe ein Sicherheitsrisiko. Eingemottet werden dürfen diese Zeitbomben dennoch nicht, weil der Kreml zumindest auf dem Papier nicht schwächer dastehen will als die USA und ihm die Atomraketen als Beweis seines Großmachtstatus gelten.
Geteilter Ansicht sind die Experten über die Ankündigungen des Verteidigungsministers, neue Super-Atomwaffen zu entwickeln. Die einen sehen darin ein neues Bedrohungspotential, andere hingegen eher einen Etikettenschwindel, wie der Militärexperte Alexander Golz: »Man sagt, man habe Raketen, die den US-Raketenschirm durchschlagen könnten. Das stimmt. Aber nur den Schutzschirm, den einst Ronald Reagan bauen wollte, und nicht den neuen, den George W. Bush plant.«
Gefährlich für den Westen ist Russlands Armee heute weniger deshalb, weil sie eine direkte Bedrohung darstellte, als vielmehr, weil die Streitkräfte im eigenen Land ein Unsicherheitsfaktor sind. Politisch ist das russische Militär derzeit noch kein Faktor: Die Schlüsselpositionen sind mit Offizieren und Generälen besetzt, die zu Sowjetzeiten ausgebildet wurden und für die eine aktive Einmischung in die Politik oder gar ein Putsch außerhalb ihrer Gedankenwelt liegt. In den nächsten Jahren beginnt jedoch eine neue Generation von Führungskräften nachzurücken, die ihre wesentliche Prägung nach dem Zerfall der Sowjetunion erhielt. Viele Vertreter dieser jungen Offiziersgeneration fühlen sich von den Politikern verraten und missbraucht. Nationalistisches Gedankengut ist unter ihnen weit verbreitet. Auf der Kommandoebene angelangt, könnten sie versucht sein, Einfluss auf die Politik zu nehmen, sollten sie von der herrschenden Elite weiter enttäuscht sein.
Stalins Zeitbomben Das Feindesland beginnt gleich hinter dem Gemüsegarten. Die Frontlinie ist drei Meter hoch, etwas rostig und aus Metall: eine Mauer, die das Grundstück von Walentina Konduchowa durchschneidet wie einst die Zonengrenze Berlin. Falten zerklüften das Gesicht der Rentnerin zu einer Landschaft, so markant wie der nahe Kaukasus. Wenn sie hinüberblickt zu der Mauer, flackern ihre müden hellblauen Augen auf. »Sie haben gewütet wie Tiere«, flüstert die Greisin, die ihr Alter nicht kennt, und ihre schwache Stimme droht sich zu überschlagen: »Alles haben sie mir genommen. Sie verhöhnen unsere Kinder und verprügeln sie.«
Walentina Konduchowa und ihre Familie bilden die Vorhut in einem Krieg, in dem seit zwei Jahrzehnten die Waffen schweigen. Meist zumindest. »Grenzposten« nennt die Ossetin ihr Haus. Hinter der Mauer, gleich nach dem Kartoffelfeld hat sich der Feind festgesetzt: Dort beginnen die Gemüsegärten der inguschetischen Nachbarn. Konduchowa kann nicht sagen, wann dieser Krieg begonnen hat. Es ist, als habe es nie Frieden gegeben.
Konduchowa lebt in Tschermen, einem geteilten Dorf in Nordossetien, zehn Autominuten von Beslan entfernt und drei Flugstunden von Moskau. Es ist, als ob eine unsichtbare Mauer die ganze 6000-Einwohner-Gemeinde durchzieht. Der Flecken ist getrennt in inoffizielle Sektoren. Militärbollwerke aus Beton mit Schießscharten halten beide Seiten in Schach. In das Bellen der Hunde mischen sich stramme Kommandos: Soldaten in grünbraunen Kampfuniformen mit Kalaschnikows und schusssicheren Westen stapfen in einem fort über die Lehmstraßen. Marschieren gegen den Hass.
Der Konflikt zwischen Osseten und Inguschen im Schatten der Geschichte
In Tschermen leben auf engstem Raum zwei Kaukasus-Völker, die für Ausländer kaum voneinander zu unterscheiden sind: Osseten und Inguschen. Außer Hass verbindet sie nichts. Moskau teilt und herrscht. »Ohne uns würden sie sich die Köpfe einschlagen«, heißt es im Kreml. »Moskau hetzt uns seit Generationen gegeneinander auf«, heißt es im Kaukasus. Tschermen liegt im Prigorodnij-Bezirk. Der war einst Teil Inguschetiens. Dann setzte Stalin in Moskau den Stift auf der Landkarte an und sprach den Landfetzen Ossetien zu. Die so gesäte Zwietracht blüht bis heute: Inguschen und Osseten gehen in Tschermen in getrennte Schulen, kaufen in getrennten Geschäften ein, und sogar die Post wird von unterschiedlichen Boten gebracht. Gemeinsam haben sie nur die Probleme: Armut, Arbeitslosigkeit, eine unsichere Zukunft.
Nach dem Kindermassaker in Beslan im September 2004 stellte Moskau in dem umstrittenen Gebiet an jeder Straßenecke Panzerwagen auf. Unter den Beslan-Tätern waren viele Inguschen, die 331 Opfer waren Osseten. Das verhieß nichts Gutes in einem Landstrich, in dem die Blutrache zur Tradition gehört wie in Bayern der Kirchgang. »Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es kracht«, mahnte ein Polizei-Offizier in Tschermen.
Einen Steinwurf vom Dorfrand entfernt beginnt Inguschetien. Eigentlich ist es eine Grenze wie zwischen zwei Bundesländern, zwischen Hessen und Niedersachsen zum Beispiel. Doch was da in der Landschaft steht, erinnert an die Zonengrenze aus DDRZeiten: Betonmauern mit Stacheldraht-Spitzen, Schlagbäume, Schießscharten, Kalaschnikows überall. Kaum ein Ingusche traut sich nach Ossetien, kaum ein Ossete nach Inguschetien; selbst Taxifahrer weigern sich, über die Grenze zu fahren. Wer hinüber will, muss zu Fuß durch das Niemandsland.
1992 überquerten hier inguschetische Freischärler die Grenze. »Meinen ältesten Sohn haben sie gefangen genommen, sein Haus verwüstet«, erinnert sich die Greisin Konduchowa. »Als er zurückkam, war er ein gebrochener Mann.«
Maka Misijewa sieht die Sache ähnlich. Ein Grundstück von den Konduchows entfernt sitzt die alte, fast blinde Frau auf einem Schemel im Freien und säubert Bohnenstauden. Maka ist etwa so alt wie ihre Nachbarin Walentina – so genau weiß das hier im Kaukasus keiner. Beide haben tiefe Furchen im Gesicht, beide erzählen fast das Gleiche, beide machen sich die gleichen Sorgen. Beide leben von ihren Gärten, weil ihre Kinder keine Arbeit haben. Beide fühlen sich einsam. Eigentlich hätte aus der Nachbarschaft längst Freundschaft werden müssen. Doch die beiden leben in unterschiedlichen Welten, mit unterschiedlichen Wahrheiten: Walentina ist Ossetin, Maka ist Inguschin.
»Ich habe nichts gegen die Osseten«, sagt Maka. »Aber Tschermen war immer inguschetisch, ich bin hier geboren!« Zweimal ist die Kolchose-Arbeiterin aus ihrem Zuhause vertrieben worden: Von den Russen nach Kasachstan und von den Osseten nach Inguschetien. Zwar spielte die Religion im Kaukasus nie eine allzu große Rolle, und bis heute geben alte Traditionen und heidnische Bräuche den Ton an. Dennoch war das christliche Ossetien Moskau stets ein Vorposten zum islamischen Nordkaukasus und seinen Nachbarn deshalb suspekt. Die Inguschen wiederum, Brudervolk der abtrünnigen Tschetschenen, gelten Moskau als unsichere Kantonisten. Stalin ließ sie in Viehwaggons nach Mittelasien umsiedeln. »An jedem Bahnhof schmissen sie Leichen aus dem Waggon«, erinnert sich Maka. Ihre wässrigen Augen blicken ins Leere. Tausende Osseten erhielten 1944 den Umsiedlungsbefehl in den Prigorodni-Bezirk. Sie mussten die leer stehenden Häuser der deportierten Inguschen beziehen. So auch die Konduchows.
Ende der fünfziger Jahre rehabilitierte Chruschtschow die Inguschen. Sie durften in ihre Dörfer zurückkehren. Doch nicht in ihre Häuser: »In meinem Geburtshaus lebten Osseten, wir durften nicht rein, wir mussten ganz von vorne anfangen«, erinnert sich Maka. Sechs ihrer zehn Kinder hatte die Kolchose-Arbeiterin zuvor im rauen Klima Kasachstans verloren. Ihr Mann starb kurz nach der Rückkehr. Vier Kinder zog sie alleine groß, schuftete von früh bis spät. Bis sie 1992 wieder alles verlor: »Ossetische Freischärler griffen uns an. Sie haben unsere Babys den Schweinen zum Fraß vorgeworfen, unsere Häuser angezündet.«
Es sind fast die gleichen Worte, die gleichen Tränen, mit denen die beiden alten Frauen vom Fünf-Tage-Krieg im PrigorodniBezirk von 1992 erzählen. Jede von den Untaten der anderen Seite. Nur auf die Frage, wer den ersten Schuss abgab, hört man unterschiedliche Antworten. Belegt ist, dass Tausende Häuser zerstört wurden, dass am fünften Tag die Osseten siegten und rund 60 000 Inguschen fliehen mussten. Eine davon war Maka. Drei Jahre lang hauste sie mit ihren vier Kindern und den Enkeln, die sie schon lange nicht mehr zählt, in Inguschetien. In Zelten und Waggons. 1995 kam sie zurück. Seit neun Jahren leben die Misijews nun in ihrem Heimatdorf wie Flüchtlinge. Keiner hat Arbeit. Mit Bekannten teilen sie sich auf der Kalininstraße neun rostige Waggons und ein heruntergekommenes Gebäude, das einmal ein Kindergarten war. 100 Menschen auf engstem Raum. Im Winter ist es zu kalt, im Sommer zu warm. Als Toilette dienen ein paar windschiefe Holzverschläge im Freien. Sie sind meterweit gegen den Wind zu riechen. Jenseits der Grenze, in Inguschetien, leben bis heute 18 834 Flüchtlinge aus dem Prigorodni-Bezirk. Seit zwölf Jahren warten sie darauf, zurückzukehren. Der Sprengstoff, den Stalin im ganzen Kaukasus gelegt hat, zündelt vor sich hin. Doch auch seit dem Zerfall der Sowjetunion treibt Moskau mit der Region weiter machtpolitische Spiele. Es sind Spiele mit dem Feuer. Kremlkritiker glauben, Moskau halte die Krisenregion absichtlich in einem instabilen Zustand und nutze die Konflikte dort, um von eigenen Problemen abzulenken. Boris Jelzin ließ 1994 Truppen in Tschetschenien – eine Stunde Autofahrt von Nordossetien und Inguschetien entfernt – einmarschieren, nachdem sich die Republik für unabhängig erklärt hatte. Ein kleiner, siegreicher Krieg, so die Hoffnung seiner Berater, werde von sozialen Problemen, Korruption und Raubprivatisierung ablenken. Später nannte Jelzin den Einmarschbefehl nach Tschetschenien den größten Fehler seiner Amtszeit. Wladimir Putin ließ im Herbst 1999 nach dem Bombenterror gegen Wohnhäuser erneut Truppen in die Republik einrücken. Der zweite TschetschenienKrieg machte aus dem unbekannten Geheimdienstler einen Kriegshelden und ebnete ihm den Einzug in den Kreml. Die Terrorangst löst starke nationalistische Stimmungen aus: Zeigte die russische Gesellschaft im ersten Tschetschenien-Krieg noch Mitgefühl mit zivilen Opfern, so stellten nun Fernsehmoderatoren die Frage, ob es in Tschetschenien überhaupt eine Zivilbevölkerung gebe, die vom russischen Militär geschont werden sollte.
Der tschetschenische Präsident Aslan Maschadow, dessen Wahl 1996 von der OSZE anerkannt wurde, flüchtete in den Untergrund. Der frühere Oberst der Sowjetunion hatte nie für Ordnung sorgen können; verbrecherische Banden beherrschten das Land. Tschetschenien wurde zum rechtsfreien Raum, dem idealen Ort für dunkle Geschäfte. Entführungen waren an der Tagesordnung. Maschadow klagte, seine Hilferufe nach Moskau seien unerhört geblieben; Moskau sagt, es habe nie Hilferufe gegeben.
Illusorischer Frieden
Moskaus Truppen verwandelten die tschetschenische Hauptstadt Grosny in eine Trümmerlandschaft. Es gibt kaum ein Gebäude, an dem die Kämpfe keine Spuren hinterlassen haben. Ganze Straßenzüge und Plätze wurden in Schutt und Asche gelegt. Tausende Menschen leben in halb zerstörten Wohnungen oder gemeinsam mit den Ratten in Kellern ohne Strom, Heizung und Wasser. »Die wahren Terroristen sind nicht die Tschetschenen, sondern die russischen Militärs. Sie machen uns das Leben zur Hölle«, klagt eine Markthändlerin. Die russischen Soldaten berichten das Gegenteil: »Das sind keine Menschen! Für die ist nur ein toter Russe ein guter Russe.«
Im Juni 2000 erklärt Moskau die Kampfhandlungen in Tschetschenien für beendet. De facto dauert der Partisanenkrieg aber noch viele Jahre an. Im Jahr 2001 knüpft Moskau offenbar auch auf Druck des Westens dezente Bande mit Vertretern der Separatisten; Friedensverhandlungen scheinen nicht mehr ausgeschlossen. Nach dem Anschlag auf das World-Trade-Center in den USA am 11. September 2001 dreht sich der Wind. Moskau unterbricht die Verhandlungskontakte. Der Westen schwenkt auf die russische Linie ein, wonach der Krieg in Tschetschenien eine Anti-TerrorAktion ist. Im März 2003 lässt Moskau die Tschetschenen über eine neue Verfassung abstimmen, die sie an Russland binden soll. Kritiker bemängeln, wegen der Sicherheitslage sei eine demokratische Abstimmung nicht möglich. Jeder, der sich offen gegen das Verfassungsprojekt ausspricht, riskiert, wie Tausende zuvor spurlos vom Erdboden zu verschwinden. Wer für Ja-Stimmen wirbt, muss Angst haben, ins Visier der separatistischen Heckenschützen zu geraten. Menschenrechtler äußern den Verdacht, das Referendum könne ein Fälschungsmanöver sein und in den Wahlverzeichnissen ständen »tote Seelen«. Bei der Volkszählung im Herbst 2002 wurden mehr als eine Million Bewohner gezählt, 300 000 mehr als vor dem Beginn des Krieges 1999.
Am Tag der Abstimmung sind in den Wahllokalen mehr Soldaten als Wähler. Im Stimmlokal 377 in Grosny verkündet der Wahlleiter schon kurz nach Mittag: »Die Beteiligung liegt bei 75 Prozent. 900 von 1 205 Berechtigten haben abgestimmt.« In den Wählerverzeichnissen sind neben den meisten Einträgen nur leere Felder, aber keine Unterschriften. Der Aufforderung nachzuzählen, kommt der Wahlleiter nur widerwillig nach. Kleinlaut verkündet er kurz darauf das Ergebnis: Nur noch 420 statt 900 Wähler. Die restlichen 480 Stimmzettel in der Urne stammten von Wählern, die »nicht im Wählerverzeichnis stehen«, erklärt der Beamte. »Das sind Leute, die einfach so vorbeigekommen sind.« Also möglicherweise »tote Seelen«? Auf den Hinweis, dass dann aber in jedem Fall die Prozentzahlen nicht mehr stimmten, meint ein Wahlhelfer: »Machen Sie sich keine Sorgen, bis zum Abend kriegen wir die 80 Prozent hin.« Der Mann hält sein Versprechen. Die Wahlkommission meldet am nächsten Tag rund 80 Prozent Wahlbeteiligung für das Wahllokal: rund 900 der 1200 Wahlberechtigten hätten abgestimmt, sagt ein Sprecher.
»Nein, Wähler, die nicht im Wahlverzeichnis standen, hat es nicht gegeben«, beteuert der Mann.
Draußen vor dem Wahllokal pirschen sich Tschetschenen aus den Nachbarhäusern an die ausländischen Journalisten heran. »Das ist alles eine Farce. Von uns hier ging niemand wählen, außer denen, die beim Staat arbeiten, die müssen, sonst werden sie gefeuert«, sagt ein Mann mittleren Alters und sieht sich vorsichtig um, dass niemand mithört. »Bevor der Bus mit den Journalisten kam, fuhr ein anderer Bus vor, mit Wählern. Die hat man offenbar extra hergebracht.« Der Mann beginnt zu flüstern. »Wir leben alle in Angst hier. Ständig kommen nachts Männer in Uniform, nehmen Leute mit. Manche kommen nie wieder. Wir sind völlig rechtlos. Wir sind wie Vieh.« Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen sind in den vergangenen Jahren 3000 bis 5000 Menschen mit Wissen russischer Behörden in Tschetschenien spurlos verschwunden. Am Abend meldet der Kreml 96 Prozent Ja-Stimmen bei der Volksabstimmung. Präsident Wladimir Putin spricht von einer »höchst demokratischen Entscheidung für den Frieden«.
Im Oktober 2003 wird Moskaus Statthalter Achmat Kadyrow zum Präsidenten Tschetscheniens gewählt. Alle ernst zu nehmenden Konkurrenten zogen vor den Wahlen ihre Kandidatur zurück. Russische Menschenrechtler werfen Kadyrow vor, Wiederaufbauhilfe in Millionenhöhe unterschlagen zu haben. Mehrfach wagt Kadyrow Kritik an den russischen Behörden. So beklagt er Übergriffe des Militärs gegen Zivilisten. Im April 2004 verurteilt er einen Freispruch für russische Militärs, die nach eigenem Eingeständnis sechs tschetschenische Zivilisten getötet haben.
Am 9. Mai 2004, dem Tag des Sieges über Nazi-Deutschland, explodiert bei einer Truppenparade in Grosny eine Landmine unter der Ehrentribüne und tötet Kadyrow. Die Separatisten bekennen sich zu der Tat. Auf dem Dorfplatz in Kadyrows Geburtsdorf Zenteroj marschieren drei Tage später 3000 schwer bewaffnete junge Männer in dunklen Hosen und Jacken auf und schreien: »Allahu akbar« – »Gott ist groß«. Es sind keine Rebellen, sondern die Leibgardisten unter dem Kommando von Kadyrows
27-jährigem Sohn Ramsan. Nicht zuletzt aufgrund solcher Szenen halten viele Russen die Kämpfer von Kadyrow junior für unsichere Kantonisten und glauben nicht so recht an den Treueschwur, den ein Vorschreier in holprigem Russisch brüllt: »Präsident Putin, wir sind mit Ihnen.« Tschetscheniens Volksvertreter wollen Putin per Brief bitten, Kadyrow junior zum Präsidenten zu machen, obwohl er dazu nach der Verfassung noch drei Jahre zu jung ist.
Putin bleibt hart. Kadyrow junior darf bei den Präsidentschaftswahlen im August 2004 nicht um die Nachfolge seines Vaters kandidieren. Die wenigen Wahlbeobachter berichten erneut über Unregelmäßigkeiten und ein »makabres Schauspiel«. Ein aussichtsreicher Kandidat wird von der Wahl ausgeschlossen, weil in seinem Pass als Geburtsort »Alchan-Jurt, Tschetschenien« steht und nicht »Tschetschenische Sowjetrepublik«. Das ist so, als würde man einem Leipziger heute das Wahlrecht absprechen, weil in seinem Pass als Geburtsort Deutschland und nicht »DDR« steht. Am Wahltag weichen die Auszählungsergebnisse des tschetschenischen Innenministeriums zum Teil eklatant von denen der Wahlbüros ab, so unabhängige Beobachter. Sieger wird, wie vom Kreml gewünscht, Alu Alchanow.
Stille Leichenschau
Der 1999 in den Untergrund geflüchtete Präsident Maschadow führt derweil weiter aus dem Verborgenen die Rebellen. Der Geheimdienst FSB setzt 10 Millionen Dollar Kopfgeld auf ihn aus. Für Moskau ist er einerseits Drahtzieher des Terrors. Gleichzeitig lehnen Offizielle Verhandlungen mit ihm mit der Begründung ab, er habe keine Kontrolle über die Freischärler, die nach Moskauer Lesart allesamt Terroristen sind. Maschadow dagegen sagt, er habe nichts mit dem radikalen Islamismus am Hut. Im Winter 2005 verkündet er einen einseitigen Waffenstillstand; er erklärt sich bereit, mit den russischen »Soldatenmüttern« Gespräche aufzunehmen und einen Friedensprozess auf den Weg zu bringen. Die Chefin der »Soldatenmütter« trifft sich in Großbritannien unter Schirmherrschaft der OSZE und des Europarats mit einem Vertreter Maschadows. Erstmals seit Jahren scheinen Verhandlungen und ein Friedensprozess wieder möglich.
Einen Monat später ist Maschadow tot. Russische Einheiten haben ihn im März 2005 in einem Keller in dem tschetschenischen Dorf Tolstoj-Jurt ausfindig gemacht und erschossen. Vier Tage lang zeigt das russische Fernsehen in seinen Nachrichtensendungen den Leichnam Maschadows, der entblößt, mit Blut an Nase und Ohren, auf dem Boden liegt. Über Datum und Umstände des Zugriffs verstricken sich die Behörden in Widersprüche. Tschetscheniens Vizepremier Ramsan Kadyrow sagt, einer seiner Leibwächter habe Maschadow erschossen. Zwei Tage später korrigiert er sich: Er habe nur einen Witz gemacht.
Ohne Maschadow sind Verhandlungen mit den Rebellen ausgeschlossen. Militärisch schwächt sein Tod die Rebellen kaum. Seinen Platz würden nun Radikale einnehmen, befürchten KaukasusExperten. »Der Krieg ist für beide Seiten ein gutes Geschäft, Verhandlungen wären da hinderlich. Maschadows Initiative hat vielen missfallen«, kommentiert Alexej Malaschenko, KaukasusExperte im Moskauer Carnegie-Centrum. »Maschadow bestand nicht mehr auf einer formellen Unabhängigkeit Tschetscheniens, er forderte lediglich ein Ende der Willkür und Gesetzlosigkeit, die Moskau verbreitet.«
Der neue starke Mann in Tschetschenien ist heute der junge Ramsan Kadyrow, der nach dem Tod seines Vaters im Mai 2004 im hellblauen Trainingsanzug im Kreml vorsprach. Menschenrechtler werfen Kadyrow vor, er halte sich eine Privatarmee, mit der er in der Republik Angst und Schrecken verbreite und Menschen verschleppe. Kadyrow hat im ersten Tschetschenien-Krieg gegen russische Soldaten gekämpft; in einem Interview sagte er, er würde es wieder tun, sollten die Interessen seines Landes es erforderlich machen.
Präsident Putin zeigte sich nach einem kurzen Besuch in Grosny nach der Ermordung von Kadyrow senior im Mai 2004 regelrecht bestürzt über das Ausmaß der Zerstörung. »Vom Hubschrauber aus sieht das schrecklich aus«, sagte er über die seit Jahren völlig zerstörte Stadt. Wenn man davon ausgeht, dass er die Wahrheit sagte, bedeutet dies, dass er Opfer der eigenen Fehlinformation und Propaganda ist. Die verkündet seit Jahren, der Wiederaufbau schreite eilig gut voran. Sechs Monate nach dem Flug über Grosny beteuerte Putin im Dezember 2004 auf Deutsch bei einer Pressekonferenz im Kreuzstall des Schlosses Gottorf in Schleswig, vor dem eine Handvoll Demonstranten gegen seine Tschetschenien-Politik protestiert: »Seit drei Jahren gibt es keinen Krieg mehr in Tschetschenien. Ist schon vorbei. Sie können ruhig nach Hause gehen. Frohe Weihnachten.« Weil nur wenige Fragen zugelassen sind und diese offenbar nur von handverlesenen Journalisten gestellt werden dürfen, kann niemand nachfragen, warum die Kaukasus-Republik weiter für Journalisten gesperrt ist, warum dort weiter regelmäßig Menschen verschwinden und russische Soldaten ums Leben kommen.
Den vorherigen, achzenten Teil – Exportschlager Mafia – finden Sie hier.
Den ersten Text der Buchveröffentlichung finden Sie hier.
Meine Seite braucht Ihre Unterstützung!
Wenn Sie weiter Artikel wie diesen lesen wollen, helfen Sie bitte mit! Sichern Sie kritischen, unabhängigen Journalismus, der keine GEZ-Gebühren oder Steuergelder bekommt, und keinen Milliardär als Sponsor hat. Und deswegen nur Ihnen gegenüber verpflichtet ist – den Lesern!
1000 Dank!
Aktuell sind (wieder) Zuwendungen via Kreditkarte, Apple Pay etc. möglich – trotz der Paypal-Sperre:
Über diesen LinkAlternativ via Banküberweisung, IBAN: DE30 6805 1207 0000 3701 71 oder BE43 9672 1582 8501
BITCOIN Empfängerschlüssel auf Anfrage
Diejenigen, die selbst wenig haben, bitte ich ausdrücklich darum, das Wenige zu behalten. Umso mehr freut mich Unterstützung von allen, denen sie nicht weh tut.
Meine neuesten Videos und Livestreams
Wer übernimmt die Verantwortung? 12 ketzerische Fragen zum tödlichen Politik-Versagen von Solingen?
Solingen als Mahnmal – Gesellschaft zahlt den Preis für Wegsehen und Verdrängung bei Gewalt(-Import)
Bild: museumcomplexnso.ruMehr zu diesem Thema auf reitschuster.de