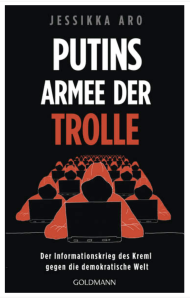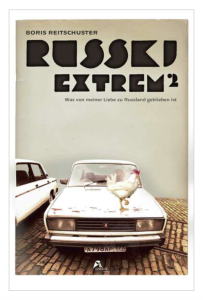Lesen Sie heute Teil 22 von „Putins Demokratur“. Warum ich Buch hier auf meiner Seite veröffentliche, können Sie hier in meiner Einleitung zum ersten Beitrag finden.
Wenn Mairbek Magomadow ständig Angst hat, liegt das nicht daran, dass er ein ängstlicher Mensch ist. Der Vizedirektor eines Moskauer Politikinstituts ist ein Baum von einem Mann, und Furcht kannte er nur von anderen. Wie es sich auch gehört für einen anständigen Tschetschenen. Doch plötzlich holte ihn der Krieg ein. Mitten in Moskau. Nicht der »richtige« Krieg mit Bomben und Schüssen – den mussten seine Freunde und Ver wandten unten in Tschetschenien durchleiden. Die Angriffe auf Magomadow erfolgen mitten in Moskau. Regelmäßig.
Er war mit seiner Frau und seinen drei Kindern auf dem Heim weg von der Datscha, als eine Milizstreife den Wissenschaftler anhielt. Statt höflich nach den Papieren zu fragen, schrien die Mi lizionäre: »Raus mit dir«, und zogen ihn vom Fahrersitz. Die Be amten stießen Magomadow in den Polizeiwagen und nahmen ihn mit auf die Wache. Fünf Stunden saß der Mittvierziger gemeinsam mit Kriminellen in einer stickigen Zelle. Seine Frau und seine Kinder mussten bis nachts um zwei Uhr im Auto ausharren – unter den Augen von Milizionären. »Wie Schwerkriminelle haben sie uns behandelt; dabei war mein einziges Verbrechen, Tschetschene zu sein«, klagt Magomadow und streckt die Hände wie zum Gebet gegen den Himmel: »Wir Kaukasier sind die Sündenböcke, die Blitzableiter, mit denen die Russen von ihren eigenen Problemen und Verbrechen ablenken. Manchmal traue ich mich kaum aus dem Haus.«
Ein Bekannter, der in der Duma arbeitet, kam dem Wissen schaftler zur Hilfe, und nach fünf Stunden konnte er die Zelle als freier Mann verlassen. Die Festnahme war eine Reaktion auf ei nen Bombenanschlag am Moskauer Puschkinplatz, bei dem im August 2000 zwölf Menschen ums Leben kamen. Wie meistens, wenn in Moskau Sprengsätze explodieren, hatten die Behörden 188eine »kaukasische Spur« ausgemacht, als noch nicht einmal alle Verwundeten versorgt waren. Keine Täter, aber massenweise Verdächtige: die »Schwarzen« oder »Schwarzärsche«, wie die Moskauer die Kaukasier verächtlich nennen.
Selbst zu Hause in ihren Wohnungen können sich die rund 200 000 Tschetschenen in Moskau nicht sicher fühlen. »Einmal in der Woche schaut die Miliz in allen Wohnungen, in denen Kaukasier wohnen, nach dem Rechten«, erzählt der Moskauer Kinderarzt Said Batajew, ein Mann mit dem Lächeln eines Film stars und die personifizierte Widerlegung aller Klischees vom kriegerischen, grimmigen Kaukasier: »Meinem Freund haben die Beamten im Jahr 2000 eine Waffe unter den Schrank geschoben, um ihn hinter Schloss und Riegel zu bekommen. Er kam nach zwei Monaten vorläufig auf freien Fuß, floh in die Niederlande und erhielt dort Asyl.
« Neben der Miliz fürchten die Kaukasier in Moskau vor allem die Stadtverwaltung. Wie alle Zugereisten müssen sie sich in der Hauptstadt regelmäßig registrieren lassen, wozu meist auch die Abnahme der Fingerabdrücke gehört. Das Recht auf einen Wohn sitz in Moskau ist mit dieser Anmeldung nicht verbunden. Damit handelt die Stadt gegen die Verfassung, die jedem Russen die freie Wahl seines Wohnorts garantiert. Das Verfassungsgericht verur teilte die Moskauer Sonderregeln. Ohne Folgen.
Statt zu mehr Ordnung führen die Regelungen zu mehr Bestechung, wie die offizielle tschetschenische Landesvertretung in Moskau beklagt. Viele Tschetschenen können sich die hohen Bakschisch-Summen für die Registrierung nicht leisten und müssen dann die Milizionäre bestechen, wenn sie bei einer Kontrolle ohne Meldebescheinigung angetroffen werden. »Und wer dunkle Haare und dunkle Augen hat, wird auf Schritt und Tritt angehalten von Milizionären«, klagt Kinderarzt Batajew. Zeitweise meiden sogar Franzosen und Italiener aus Angst vor Übergriffen den öffentlichen Nahverkehr.
Moskauer Tschetschenen klagen, der Eintrag »Tschetschene« im Pass sei schlimmer als eine Vorstrafe; so lehnen etwa Arbeitgeber immer wieder die Einstellung von Tschetschenen ab, weil sie Ärger mit den Behörden fürchten. Auch tschetschenische Geschäftsleute klagen über Druck. Naschmudi Amirchanow etwa musste seine Zoll-Service-Firma mit 140 russischen Mitarbeitern aufgeben: »Eines Tages kam die Miliz und sagte: ›Du bist Tschetschene. Wenn du weiter Geschäfte machst, bringen wir dich hinter Gitter.‹ Den Kunden sagten sie: ›Wenn ihr weiter mit dem Tschetschenen zusammenarbeitet, bekommt ihr Ärger!‹ Wie mit den Juden früher in Deutschland. Nicht einmal meine Kinder haben Ruhe. Die werden in der Schule verprügelt.«
Nach der Moskauer Geiselnahme während des »Nord-Ost«-Musicals im Jahr 2003 druckte die Iswestia den Kommentar eines bekannten Fernsehmoderators ab. Es stimme nicht, dass es keine verbrecherisch veranlagten Völker gebe, der Tschetschene an sich neige zum Mord, heißt es in dem Artikel. »Die unmittelbare Nähe eines Tschetschenen, etwa auf einem Flughafen, rufe zu Recht die gleichen Gefühle hervor wie ein herrenlos herumstehender Koffer, bei dessen Anblick jeder intelligente Mensch einen Polizisten herbeirufen wird.« Die Empfehlung des Fernsehjournalisten: die Tschetschenen in die Berge zu verschleppen und dort mit Stacheldraht und Minenfeldern in Schach zu halten.
Im Wahlkampf für die Moskauer Stadt-Duma im Dezember 2005 machte die vor den Duma-Wahlen 2003 auf Betreiben des Kreml gegründete nationalistische Vaterlandspartei Wahlwerbung mit einem Video, das Kaukasier zeigte, die Wassermelonen aßen und die Schalen auf den Boden warfen. Zwei Vaterlands-Politiker fordern die beiden auf, ihren Müll wegzuräumen, doch die Kaukasier können kein Russisch und verstehen sie nicht.
Darauf spricht einer der Politiker in die Kamera: »Lasst uns Moskau vom Müll säubern«, womit er auf die Kaukasier anspielt. Die Wahlkommission nahm den umstrittenen Werbespot zum Anlass, die Vaterlandspartei von den Wahlen auszuschließen. Die dem Kreml ebenfalls nahestehenden radikalen Nationalliberalen von Wladimir Schirinowski durften dagegen ungestört mit Parolen wie »Schließt Moskau ab vor Südländern!« oder »Wir sind für eine Stadt mit russischen Gesichtern. Illegale haben keinen Platz in der Hauptstadt« Wahlkampf treiben. 70 Prozent aller Verbrechen in Moskau würden von Zuwanderern begangen, heißt es in einem Flugblatt an die Wähler: »Das ist ein Verbrechenskrieg gegen Sie, die Moskauer! Die Auswärtigen treiben die Preise auf den Märkten in die Höhe und schlagen damit gegen Ihren Geldbeutel und Magen.« Weiter heißt es: »Keine Aufnahme neuer Arbeiter aus dem Ausland! Wenn wir Moskau nicht verschließen gegen Immigranten, wird es brennen, wie heute Europa brennt.«
Tatsächlich ist die enorme Zuwanderung nach Moskau ein großes Problem; die Hauptstadt platzt aus allen Nähten. Dies liegt aber vor allem an der starken Zentralisierung: 80 Prozent aller Finanzströme im Land sind in der Hauptstadt konzentriert; viele Unternehmen, die in der Provinz arbeiten, haben ihren Sitz in Moskau und zahlen dort Steuern. Dass die Menschen dem Geld hinterherziehen, ist verständlich. Solche Zusammenhänge werden in den Medien jedoch kaum thematisiert. Statt die eigenen Politiker und Wirtschaftsführer wegen ihrer Zentralisierungspolitik anzugreifen, attackiert man deren Opfer – die Zuwanderer. Als die junge Moskauerin Mascha im Frühjahr 2006 ein Restaurant für ihre Geburtstagsfeier sucht, empfehlen Bekannte ihr die Bar »Stoi!ka« – wörtlich übersetzt: »Stopp!« Das Essen ist preiswert, der Saal gemütlich, und Mascha ist sich mit dem Restaurantleiter schnell über die Speisenfolge einig. Als sie schon über die Anzahlung reden, lächelt der Mann plötzlich freundlich und sagt, er habe etwas vergessen. Der Name der Bar habe eine doppelte Bedeutung: »Wir haben zwei eiserne Regeln. Keine stark Betrunkenen und keine Kaukasier.« Sie habe auch Aserbaidschaner unter ihren Freunden – solide Geschäftsleute, gebürtige Moskauer –, erwidert die überraschte Mascha. »Und selbst wenn sie mit dem Hubschrauber kommen – die lassen wir nicht rein«, entgegnet er.
»Stoi!ka« ist keine einzelne Bar, sondern gehört zu einer Kette. Wer sich auf deren Homepage per Kurzformular um einen Job bewarb, musste bis vor kurzem unter Punkt fünf seine Nationalität angeben. Bei Testanrufen von Journalisten hieß es in allen »Stoi!ka«-Bars, Kaukasiern sei der Zutritt verwehrt – »ihrer eigenen Sicherheit zuliebe«, weil die Besucher oft Schlägereien mit Kaukasiern anfingen. Ausnahmen seien möglich, wenn jemand intelligent aussehe und die kaukasischen Gesichtszüge nicht zu stark ausgeprägt seien, erklärte eine Angestellte. Medienberichten zufolge gibt es auch andere Restaurants und Clubs, in denen solche Apartheidsregeln gelten: meist inoffiziell, zuweilen aber auch schwarz auf weiß nachzulesen.
Der Hass auf die Kaukasier ist nicht neu. Neu ist, dass er hoffä hig und zu einem Massenphänomen wurde. Noch 1989 tadelten 53 Prozent der Russen bei einer Umfrage jede Art ethnischer Intoleranz; nur 20 Prozent bekannten sich offen zum Fremdenhass, der vor allem an der sozialen Peripherie verbreitet war – in Kleinstädten etwa, bei Rentnern und sozial Schwachen mit geringer Bildung. Seit Ende der neunziger Jahre ist eine starke Ausweitung von Fremdenhass und Xenophobie zu beobachten: 2004 teilten bei einer Umfrage bereits zwei Drittel der Befragten antikaukasische Vorurteile. Als Grund gaben 68 Prozent die »Andersartigkeit der Kaukasier« und ihren starken Zusammenhalt untereinander an. Die wahren Gründe dürften tiefer liegen. Den Zerfall der Sowjetunion empfanden viele Russen als persönliche Niederlage, die
sie mit dem Gefühl ethnischer Überlegenheit auszugleichen versuchen. Nationalitätenkonflikte und soziale Probleme im Kaukasus führten darüber hinaus zu einem starken Zuzug von Menschen aus dieser Region in russische Großstädte. Viele Migranten brachten es dank ihres starken Zusammengehörigkeitsgefühls rasch zu wirtschaftlichem Wohlstand, was Neid auslöste. Zahlreiche kriminelle Banden aus dem Kaukasus treiben ihr Unwesen in ganz Russland und gehen zuweilen mit äußerster Brutalität gegen ihre Opfer vor. Während die Menschen bei Übergriffen von Banditen ihrer eigenen Nationalität keine negativen Rückschlüsse auf das eigene Volk ziehen, übertragen viele ihren durchaus verständlichen Hass auf kaukasische Kriminelle auf alle Menschen dieser Region.
'Tote Neger'
Manchmal ergeht Gnade vor Recht. Im März 2006 sitzen in Petersburg zwölf Geschworene über acht Angeklagte zu Gericht. Viele Verdächtige sind noch sehr jung, die meisten nicht einmal volljährig. Wohl deshalb war die sonst sehr strenge Staatsanwaltschaft ausnahmsweise mild in ihren Anträgen. Die Geschworenen kommen zu dem Schluss, dass einer der jungen Männer unschuldig ist und die anderen sieben sich des »Rowdytums« schuldig gemacht haben. Ein Straftatbestand, der etwa für Zusammenstöße von Fußballfans angewandt wird.
Dreizehn Monate vor dem Urteil, am 9. Februar 2004, sind die acht jungen Männer im Adimiralitätsviertel von Sankt Petersburg offenbar zufällig einer Familie aus der früheren Sowjetrepublik Tadschikistan in Mittelasien über den Weg gelaufen. Auch die Tadschiken werden wegen ihrer dunklen Hautfarbe in Russland oft »Schwarze« genannt. Der 35-jährige Junus Sultonow ist mit seiner neunjährigen Tochter Churschede und seinem elfjährigen Neffen Alabir gerade auf dem Heimweg vom Eislaufen. Plötzlich fallen die jungen Männer über den Vater und die zwei Kinder her. Der elfjährige Alabir rettet sich mit einer Gehirnerschütterung
und Prellungen am Kopf unter ein geparktes Auto. Die neunjährige Churschede schafft das nicht mehr. Als der Krankenwagen eintrifft, ist sie verblutet. Die Ärzte zählen elf Messerstiche in dem kleinen Körper, Schlag- und Stichverletzungen auf der Brust, am Bauch und an den Armen.
Nach dem Schuldspruch wegen Rowdytums erhalten die Angreifer Haftstrafen zwischen anderthalb und fünfeinhalb Jahren. Die Staatsanwaltschaft hatte nur den Hauptverdächtigen, der zur
Tatzeit 14 Jahre alt war, wegen Mordes angeklagt; die Geschworenen jedoch sahen diesen Vorwurf nicht als erwiesen an. Bei den mutmaßlichen Komplizen ging die Staatsanwaltschaft gar nicht erst von Beihilfe aus, sondern nur von Rowdytum. »Aus Hass zu Nichtrussen, vorsätzlich mit dem Ziel, das Mädchen zu ermorden, das sich aufgrund seines Alters nicht wehren konnte und von Anfang an in einer hilflosen Lage war, brachte einer der Angeklagten ihr mindestens sieben Messerstiche bei, in deren Folge sie starb«, heißt es im Plädoyer der Ankläger. Sie legen gegen das Urteil Rechtsmittel ein.
Aus dem Internet können Rechtsradikale sich ein »Handbuch für den Straßenterror« herunterladen, wo ausführlich beschrieben wird, wie man Menschen tötet. Rechtsradikale rufen zu »weißen Patrouillen« in Sankt Petersburg auf, bei denen jeweils 25 Skinheads die Straßen »säubern« sollen. Die Miliz versucht in vielen Fällen, Gewalttaten mit rechtsradikalem Hintergrund als gewöhnliche Kriminalität einzustufen. In Sankt Petersburg gingen in so einem Fall Rechtsradikale selbst an die Öffentlichkeit und klagten, die Miliz lüge und verschweige den wahren – fremdenfeindlichen – Charakter der Tat. Nach einer Meinungsumfrage gaben 41 Prozent der Milizionäre an, die Parole »Russland den Russen« zu unterstützen; 67 Prozent sagten, sie empfänden »Furcht, Argwohn und Gereiztheit« gegenüber Menschen aus dem Kaukasus.
In den ersten vier Monaten des Jahres 2006 wurden in Russland offiziell 14 Menschen aus fremdenfeindlichen Motiven umgebracht und 92 verletzt. Allein in Moskau gab es neun Todesopfer.
Nach Angaben des Moskauer Menschenrechtsbüros leben in Russland 50 000 Skinheads, davon allein in Moskau 2000, neben mehreren tausend Mitgliedern anderer nationalistischer Bewegungen.
In vielen Fällen trauen sich die Opfer der Radikalen aus Angst gar nicht zur Polizei, wie ein Hochschulrektor aus Petersburg berichtet: »Es gab Fälle, in denen Studenten um Hilfe baten, und stattdessen nahmen die Beamten ihnen ihr Geld ab.« Nach Protesten wegen zahlreicher Übergriffe auf Gaststudenten aus Afrika und Asien fand die Stadtverwaltung im November 2004 eine ungewöhnliche Lösung. Weil die Polizei überfordert ist und die Täter nicht fassen kann, kündigte die Behörde an, die Opfer demnächst unter die Fittiche der Sicherheitsbehörden zu nehmen: In einem neuen Studienzentrum sollen sie regelrecht kaserniert werden und in Gesprächen mit Psychologen, Soziologen und Sicherheitsbeamten über die Tücken des russischen Alltags aufgeklärt werden. Ihre Freizeit sollen sie gemeinsam verbringen, unter Bewachung. Eine Kapitulation vor dem Rassismus. Der ist inzwischen allgegenwärtig: Russland im Jahr 2003. In der Hitparade landet die Musik-Gruppe »Verbotene Trommler« einen Hit mit einem Lied mit dem Titel »Sie haben einen Neger umgebracht«. Im Original-Text
lautete der Refrain: »Ai-ja-ja-ja-ja-jai, einfach so, ohne Grund, abgeschlachtet haben sie ihn, die Hunde.« Die Autoren spielen mit rassistischen Motiven und lassen den »Neger« durch einen Hexenmeister als Zombi wieder auferstehen. Auf den Straßen ist zuweilen ein anderer Reim zu hören: »Ai-ja-ja-ja-ja-jai, sie haben einen Neger umgebracht, und es ist nicht schade, es macht nichts.«
Juni 2005, Moskau, auf einer Pressekonferenz. Ein britischer Journalist fragt Präsident Putin, ob man die Probleme Russlands mit seinen Schulden und der Demokratie nicht mit ähnlichen Problemen afrikanischer Länder vergleichen könne. Antwort Putin: »Wir wissen, dass es in einigen afrikanischen Ländern bis vor kurzem praktiziert wurde, seine politischen Gegner aufzuessen.
Wir praktizieren das nicht, deshalb ist ein Vergleich mit solchen
Ländern unzulässig.«
April 2006, Baku. In der Flughafenbar flimmern Hip-Hop-Videos über den Fernseher. Ein russischer Geschäftsmann empört an die Bedienung: »Macht es Ihnen nichts aus, dass hier Neger auf dem Bildschirm gezeigt werden? Warum schalten Sie nicht um?
Ich wüsste, an welchen Ort man die alle schicken sollte …« Die junge Frau – eine Aserbaidschanerin mit dunklem Teint – sieht ihn fassungslos an. Sie zittert.
Den vorherigen, zwanzigsten Teil – Der kaukasische Teufelskreis – finden Sie hier.
Den ersten Text der Buchveröffentlichung finden Sie hier.
“Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd“
sagt ein altes chinesisches Sprichwort. Bei uns ist es wohl eher ein guter Anwalt – und der kostet Geld. Augsburgs CSU-Oberbürgermeisterin Eva Weber hat mich gerade angezeigt, weil ich es gewagt habe, ihre Amtsführung zu kritisieren. Es geht um mehr als nur diesen Fall. Es geht um das Recht, Kritik an den Mächtigen zu üben, ohne kriminalisiert zu werden. Helfen Sie mir, dieses wichtige Recht zu verteidigen! Jeder Beitrag – ob groß oder klein – macht einen Unterschied. Zusammen können wir dafür sorgen, dass unabhängiger Journalismus stark bleibt und nicht verstummt. Unterstützen Sie meine Arbeit:
1000 Dank!
Aktuell sind (wieder) Zuwendungen via Kreditkarte, Apple Pay etc. möglich – trotz der Paypal-Sperre:
Über diesen LinkAlternativ via Banküberweisung, IBAN: DE30 6805 1207 0000 3701 71 oder BE43 9672 1582 8501
BITCOIN Empfängerschlüssel auf Anfrage
Diejenigen, die sdeeldbst wenig haben, bitte ich ausdrücklich darum, das Wenige zu behalten. Umso mehr freut mich Unterstützung von allen, denen sie nicht weh tut.
Meine neuesten Videos und Livestreams
Die Deutschen wollen es offenbar nicht anders: „Weiter so“ als großes Signal der Landtagswahlen
Wer übernimmt die Verantwortung? 12 ketzerische Fragen zum tödlichen Politik-Versagen von Solingen?
Bild: a.d-cd.netMehr zu diesem Thema auf reitschuster.de