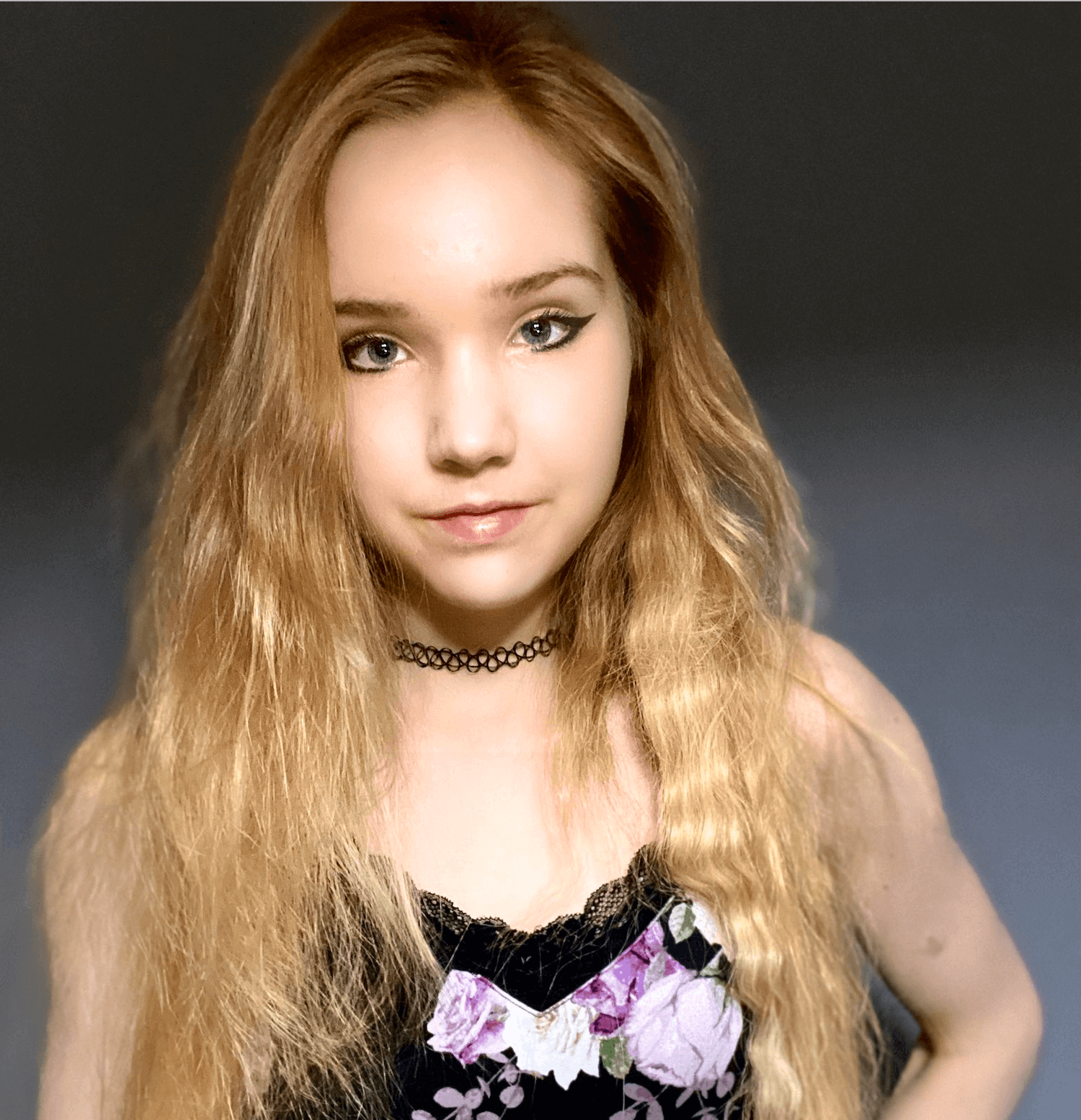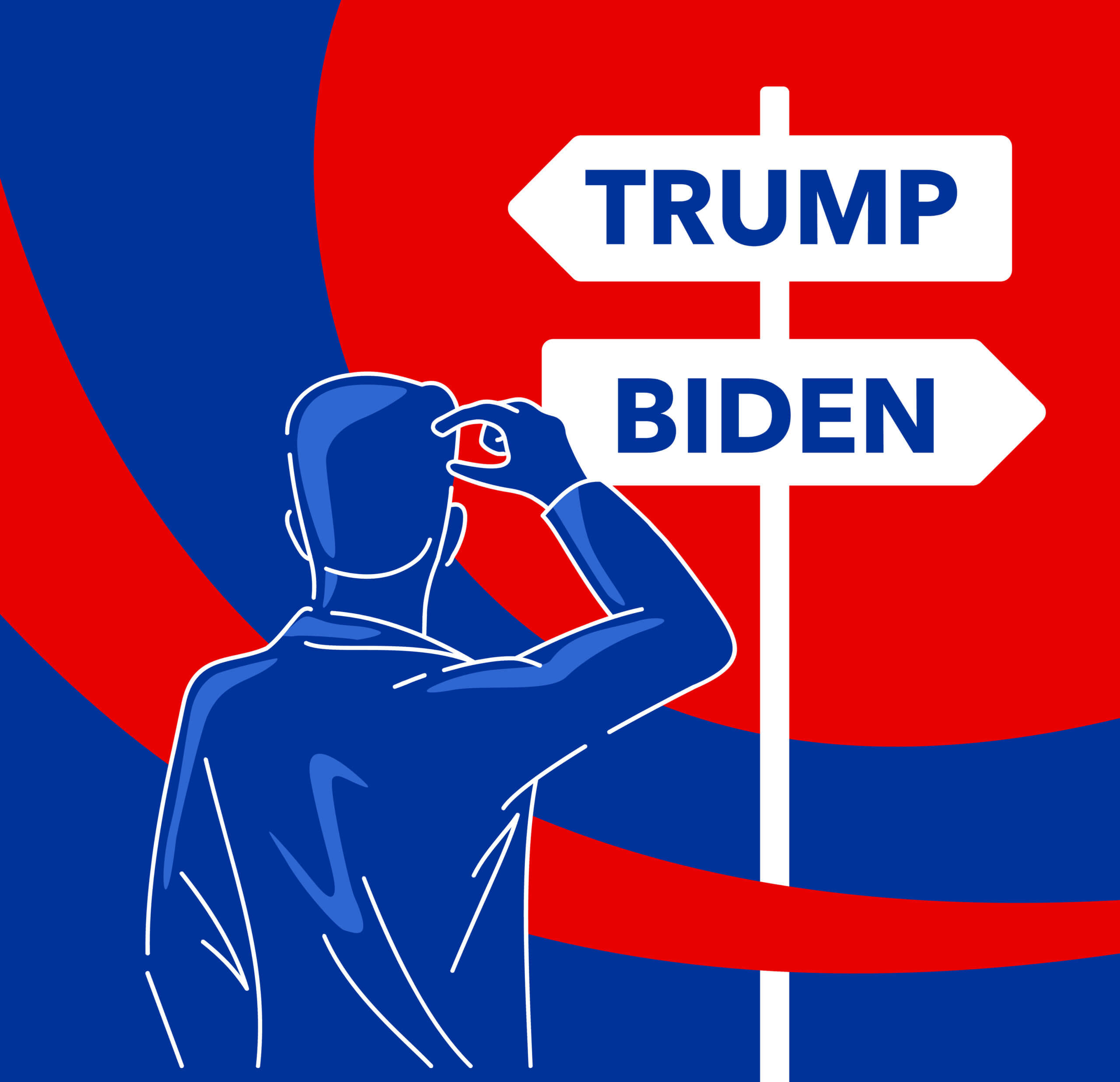Ein Gastbeitrag von Prof. Felix Dirsch
Wenn es noch eines Beweises für die Spaltung der USA bedurft hätte, von der in den letzten Jahren oft die Rede war, dann hat ihn der so genannte Sturm auf das Kapitol auf für viele schockierende Weise geliefert. Die Ereignisse überschatten die Vereidigung des neuen US-Präsidenten, die traditionell die Einheit des amerikanischen Volkes fördern soll. Nicht von ungefähr steht im Mittelpunkt der Zeremonie am 20. Januar der Schwur des neuen US-Präsidenten auf die Bibel Abraham Lincolns. Dieses zivilreligiöse Ritual hat wenig mit persönlichem Glauben zu tun. Primäres Ziel ist es, sozialen Kitt zu generieren: „Wir alle sind ein Amerika“, so die emphatische Botschaft des Tages.
Dieser säkularisiert-sakrale Brauch wird nicht zufällig in einem Land praktiziert, das von Anfang an eine strenge Trennung von Staat und Kirche favorisierte, um religiöse Toleranz und Pluralität zu ermöglichen. Der französische Schriftsteller Alexis de Tocqueville, der im frühen 19. Jahrhundert die USA bereiste, war überrascht, wie sehr Formen protestantischer Religiosität auf das dortige Zusammenleben ausstrahlen und halfen, Freiheit wie Gleichheit auszubilden. Dieser über lange Zeit hinweg konsensstiftende Hintergrund hinterlässt auch in Zeiten wachsender Spannungen seine Spuren.
Ob solche alten, aber gleichwohl nicht veralteten Rituale der Traditions- und Einigkeitsvergewisserung den Riss verkleinern können, ist zweifelhaft. Für die global-gleichgeschalteten Hauptstrommedien ist klar, dass der scheidende Präsident, wenn nicht zum Staatsstreich aufgerufen hat, so doch mit seiner aufwieglerischen Rede die Schuld an der Entweihung des heiligen Tempels am 6. Januar 2021 trägt. Da ist es letztlich egal, dass sich in der emotionalen Ansprache Donald Trumps kein direkter Bezug zu den gewalttätigen Orgien im Anschluss findet, schon gar kein direkter Aufruf. Man kann ihm natürlich den Vorwurf machen, nicht entschieden dagegen gesteuert zu haben, als absehbar war, dass sich der Zug der Krawallmacher in Richtung Kapitol bewegt. Hauptsächliches Ziel Trumps dürfte es gewesen sein, jenen US-Republikanern im Senat, die Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Wahl hatten, den Rücken zu stärken, obwohl klar war, dass sich das Ergebnis (ungeachtet der Betrugsvorwürfe) nicht mehr kippen lässt. Ein Teil der Wut-Demonstranten hat dies wohl geglaubt und seiner Enttäuschung aggressiv Ausdruck gegeben.
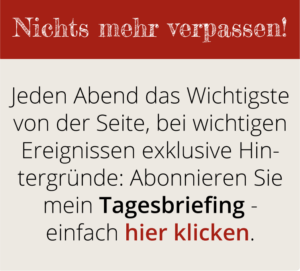 Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass ein Vertreter der popkulturellen Linken Europas, der slowenische Philosoph Slavoj Žižek, aus dem medialen Einheitsbrei ausscherte. Er gab den Trump-Anhängern in der „Welt“ grundsätzlich recht, dass „sie gegen das US-Wahlsystem mit seinen komplizierten Mechanismen protestierten, deren Ziel es ist, einen direkten Ausdruck der Unzufriedenheit des Volkes unmöglich zu machen (…). Aber ihr Angriff war kein faschistischer Putsch (…)“. Man meint, den nationalrevolutionären Publizisten Jürgen Elsässer zu vernehmen.
Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass ein Vertreter der popkulturellen Linken Europas, der slowenische Philosoph Slavoj Žižek, aus dem medialen Einheitsbrei ausscherte. Er gab den Trump-Anhängern in der „Welt“ grundsätzlich recht, dass „sie gegen das US-Wahlsystem mit seinen komplizierten Mechanismen protestierten, deren Ziel es ist, einen direkten Ausdruck der Unzufriedenheit des Volkes unmöglich zu machen (…). Aber ihr Angriff war kein faschistischer Putsch (…)“. Man meint, den nationalrevolutionären Publizisten Jürgen Elsässer zu vernehmen.
Jenseits der medialen Empörungswellen bleiben die Untersuchungen der Ausschreitungen abzuwarten. Dass die (auch strafrechtliche) Aufarbeitung vielschichtig ist, hat nicht zuletzt die Verhaftung John Sullivans gezeigt. Der linksextreme Aktivist von „Black Lives Matter“ (BLM) wurde jetzt vom FBI festgenommen. Er hat wohl nach Zeugenaussagen und Kameramitschnitten einen erheblichen Anteil daran gehabt, den Sturm auf das Kapitol anzuführen und die Aktivisten zur Brandstiftung und Sachbeschädigung anzustacheln.
Nicht nur die Rolle eines in einschlägigen Kreisen bekannten Agent Provocateur sollte in Erinnerung rufen, dass die zum Teil blutigen Auseinandersetzungen der letzten Jahre größtenteils auf Linksextreme zurückzuführen sind. Sie haben viele Geschäfte geplündert und Stadtviertel zerstört. Die Versicherungsschäden werden zwischen ein bis zwei Milliarden US-Dollar geschätzt. Zwei Morde wurden besonders diskutiert: Während der Unruhen in St. Louis tötete der Antifa-Mob einen pensionierten afroamerikanischen Polizeihauptmann mit Namen David Dorn. Den Bundesbeamten Dave P. Underwood trafen anlässlich einer BLM-Demonstration in Oakland tödliche Schüsse, abgefeuert von einem Aktivisten der Bewegung. Solidaritätshandlungen seitens des politischen Establishments blieben aus, anders als bei der Tötung des Farbigen George Floyd. Wie heuchlerisch die Betroffenheitsrhetorik der US-demokratischen Führungsriege einzustufen ist, wird an folgender Begebenheit deutlich: Die neue US-Vizepräsidentin rief kürzlich dazu auf, dem „Minnesota Freedom Fund“ finanziell unter die Arme zu greifen. Diese Organisation entstand auch deshalb, um Kautionen für linke Randalierer zu zahlen.
Nicht nur die einseitige Parteilichkeit mancher Führergestalten der US-Demokraten macht den vorgeblichen Wunsch Joe Bidens „versöhnen statt spalten“ wenig glaubwürdig. Selbst wenn er aufrichtig gemeint sein sollte, wird er schwer umzusetzen sein. Die Polarisierung geht weit zurück. Ein kurzer historischer Rückblick lohnt also.
Es klingt heute wie ein Märchen aus vergangenen Tagen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die USA lange als relativ unideologische Gesellschaft galten. Weltanschauliche Streitigkeiten, wie sie in Europa bis ungefähr Mitte des 20. Jahrhunderts extreme Ausmaße erreichten, fehlten weithin. Daran änderten auch Konflikte um die einschneidende New-Deal-Gesetzgebung Franklin D. Roosevelts in den 1930er Jahren nichts. Schon 1906 stellte der deutsche Ökonom Werner Sombart die seither öfters aufgeworfene Frage, warum es keinen Sozialismus in den USA gebe. Diese Tatsache erstaunte vor allem deshalb, weil man gerade in Europa ein Gegengewicht zum als exzessiv vermuteten Kapitalismus amerikanischer Prägung vermisste. Die Frage ist heute angesichts eines erstarkenden linken Flügels der US-Demokraten durchaus aktuell. Manche liebgewonnenen Vorurteile über das so genannte Land der unbegrenzten Möglichkeiten erwiesen sich als unzutreffend. So mussten viele linke Emigranten aus Deutschland, etwa Repräsentanten der Kritischen Theorie, die Vorstellung aufgeben, dass Kapitalismus in einem bestimmten Stadium automatisch zum Faschismus führen müsse.
Große Anteile an diesem über Generationen hinweg dauernden, Stabilität garantierenden Fundamentalkonsens besitzt das Freiheitscredo. Es wird auch von den meisten derjenigen hochgehalten, die wirtschaftlich wenig davon profitieren. Auch die ethische Ausstrahlung protestantischer Überzeugungen ist bis in die Gegenwart hinein relevant.
Der breite (Verfassungs-)Konsens wurde lange kaum hinterfragt. Extremistische Minderheiten gab es gleichwohl. Kommunistische Splittergruppen trieben ebenso ihr Unwesen wie der Ku-Klux-Klan. Von der Ergreifung der Macht waren die Radikalen auf beiden Seiten weit entfernt.
Auch zwischen den großen Parteien bestanden lange Zeit keine großen Unterschiede. General Dwight D. Eisenhower bekam sowohl von Demokraten wie von Republikanern die Präsidentschaftskandidatur angetragen. Erst im Laufe der 1960er Jahre machten sich im Zuge der Studenten- und Bürgerrechtsbewegung größere Dissonanzen bemerkbar. Debatten über Rassen- und Minderheitendiskriminierung ebenso wie über den Vietnamkrieg wirkten aufwühlend. Der konservative Politiker Barry Goldwater trug maßgeblich zur Transformation der Republikaner zur Anti-Emanzipationspartei bei.
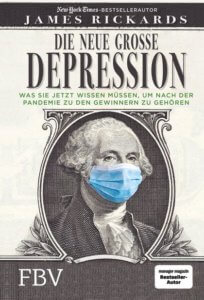 Eine weitere Zäsur stellen die 1980er Jahre dar. Vornehmlich die marktradikale Reaganomics und Reagans Antikommunismus polarisierten. Dagegen wandten sich besonders jüngere Linksintellektuelle. Die Evangelikalen, die vermehrt von sich reden machten, fanden zum großen Teil Unterschlupf bei den Republikanern. Diese konnten sich immer stärker durch die Trias „Markt, Gott, Antikommunismus“ (Torben Lütjen) profilieren. Gegen sie brachten sich zunehmend die Demokraten, einst in Teilen Anhänger der Rassengesetze, als Partei von Bürgerrechtsaktivisten in Stellung. Seit den 1990er Jahren kann man intensivierte Kulturkämpfe um Abtreibung, Todesstrafe und die öffentliche Anerkennung von Homosexualität wahrnehmen. Die Ära von George W. Bush, einem prominenten „wiedergeborenen Christen“, offenbarte innen- wie außenpolitisch erhebliches Konfliktpotenzial. Gegen die im Vergleich dazu gemäßigtere Politik von Barack H. Obama mit seinem Schwerpunkt auf moderaten staatlichen Umverteilungen („Obama Care“) bildete sich die libertäre Tea Party.
Eine weitere Zäsur stellen die 1980er Jahre dar. Vornehmlich die marktradikale Reaganomics und Reagans Antikommunismus polarisierten. Dagegen wandten sich besonders jüngere Linksintellektuelle. Die Evangelikalen, die vermehrt von sich reden machten, fanden zum großen Teil Unterschlupf bei den Republikanern. Diese konnten sich immer stärker durch die Trias „Markt, Gott, Antikommunismus“ (Torben Lütjen) profilieren. Gegen sie brachten sich zunehmend die Demokraten, einst in Teilen Anhänger der Rassengesetze, als Partei von Bürgerrechtsaktivisten in Stellung. Seit den 1990er Jahren kann man intensivierte Kulturkämpfe um Abtreibung, Todesstrafe und die öffentliche Anerkennung von Homosexualität wahrnehmen. Die Ära von George W. Bush, einem prominenten „wiedergeborenen Christen“, offenbarte innen- wie außenpolitisch erhebliches Konfliktpotenzial. Gegen die im Vergleich dazu gemäßigtere Politik von Barack H. Obama mit seinem Schwerpunkt auf moderaten staatlichen Umverteilungen („Obama Care“) bildete sich die libertäre Tea Party.
Auch die US-Demokraten sind heute deutlich weiter links positioniert als in den 1990er Jahren. Damals setzte sich Bill Clinton für die Deregulierung der Finanzmärkte ein und unterzeichnete ein Dekret („Defense of Marriage Act“), das auf Bundesebene eine andere Definition von Ehe als die Verbindung von Mann und Frau untersagte. Schon diese Beispiele sind aussagekräftig in einer Zeit, da immer mehr jüngere Verehrer von Bernie Sanders in der Partei eine stärkere Rolle zu spielen beginnen, etwa die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez. Sozialistische Entwicklungen sind langfristig wahrscheinlich, wenn auch keine überstürzten und einschneidenden.
Die Bruchlinien werden auf verschiedenen Ebenen offenkundig: zwischen Jüngeren und Älteren, zwischen städtischem und ländlichem Bereich, aber auch in demographischer Hinsicht. Die klassischen Wählerschichten der US-Republikaner, meist als „weiße, alte Männer“ pauschalisiert wie ironisiert, verlieren an Boden. Hingegen gewinnen Afroamerikaner, Hispanics und andere herkömmliche Minderheitengruppen tendenziell an Einfluss. Die aus solchen Verschiebungen resultierende Identitätskrise lässt schon jetzt Auswirkungen auf die Politik erkennen, in Zukunft wohl noch mehr. Die Filterblasen des Internets fördern ebenfalls die Herausbildung von Gegensätzen.
Man kann also unschwer wahrnehmen, dass die Person Trump und die populistische Strömung innerhalb der US-Republikaner zwei Faktoren sind, die die vorhandenen Gräben höchstens vertieft haben. Trump ist eher Folge der verlorenen Mitte als Urheber entsprechender Zustände.
[themoneytizer id=“57085-3″]

Professor Dr. Felix Dirsch lehrt Politische Theorie und Philosophie. Er ist Autor diverser Publikationen, u.a. von “Nation, Europa, Christenheit” und “Rechtes Christentum“. Dirsch kritisiert unter anderem den Einfluss der 68er-Generation und der „politischen Korrektheit“.
2020 erschienen die Bücher: „Die Stimmen der Opfer. Zitatelexikon der deutschsprachigen jüdischen Zeitzeugen zum Thema: Die Deutschen und Hitlers Judenpolitik“ (zusammen mit Konrad Löw) und „Rechtskatholizismus. Vertreter und geschichtliche Grundlinien. Ein typologischer Überblick“.
Bild: mccv/Shutterstock
Text: gast
Mehr von Prof. Dr. Felix Dirsch auf reitschuster.de