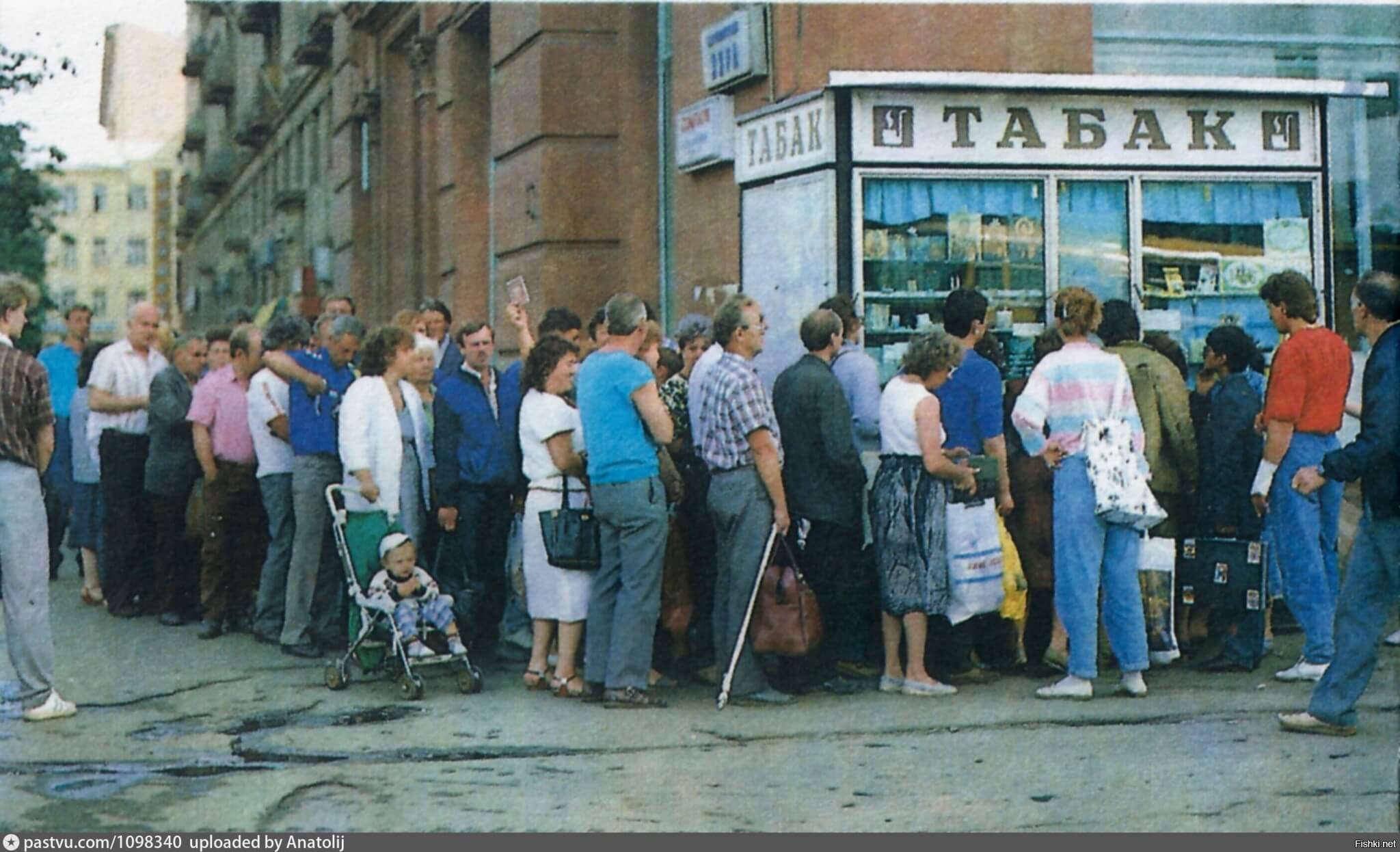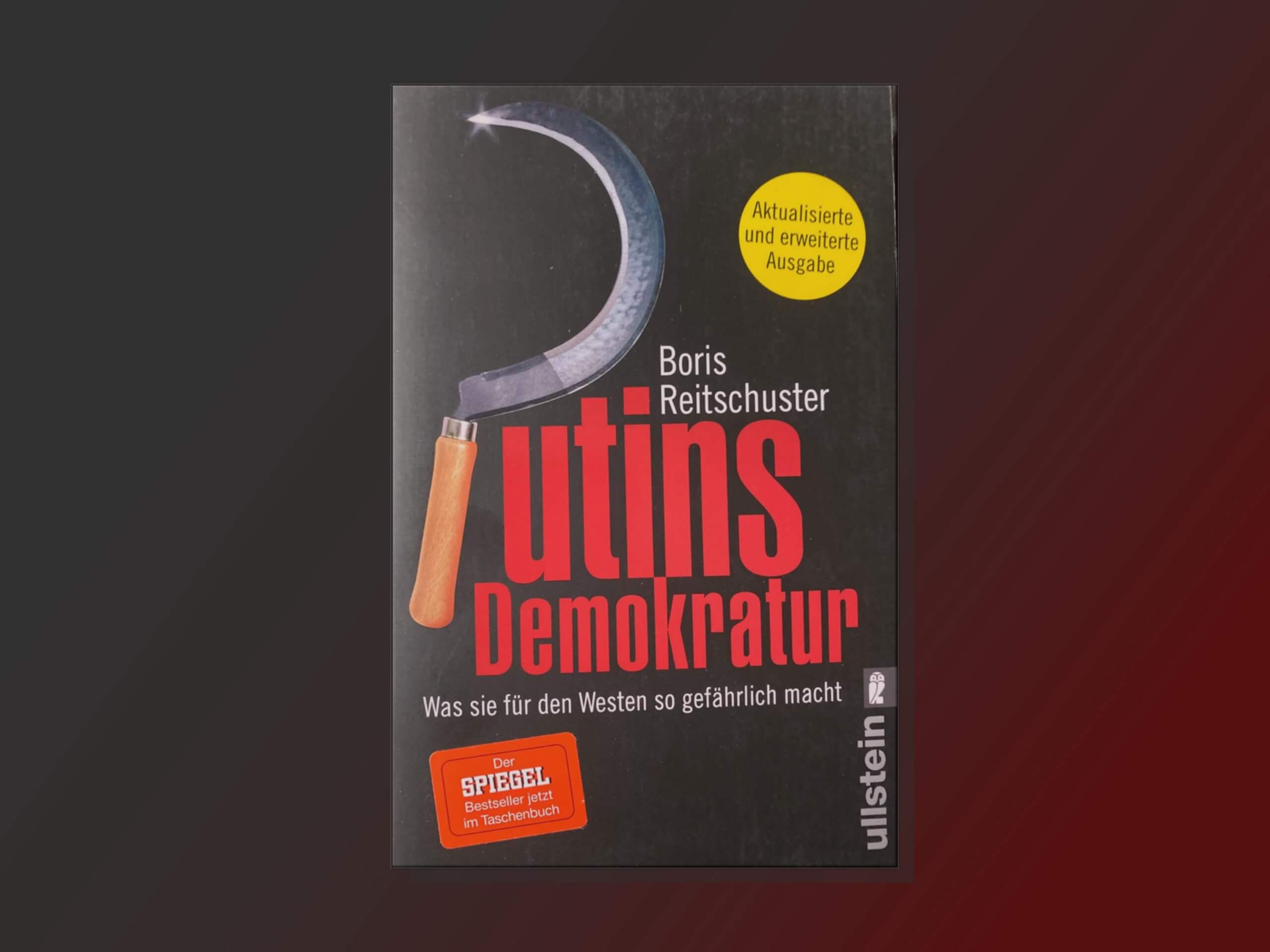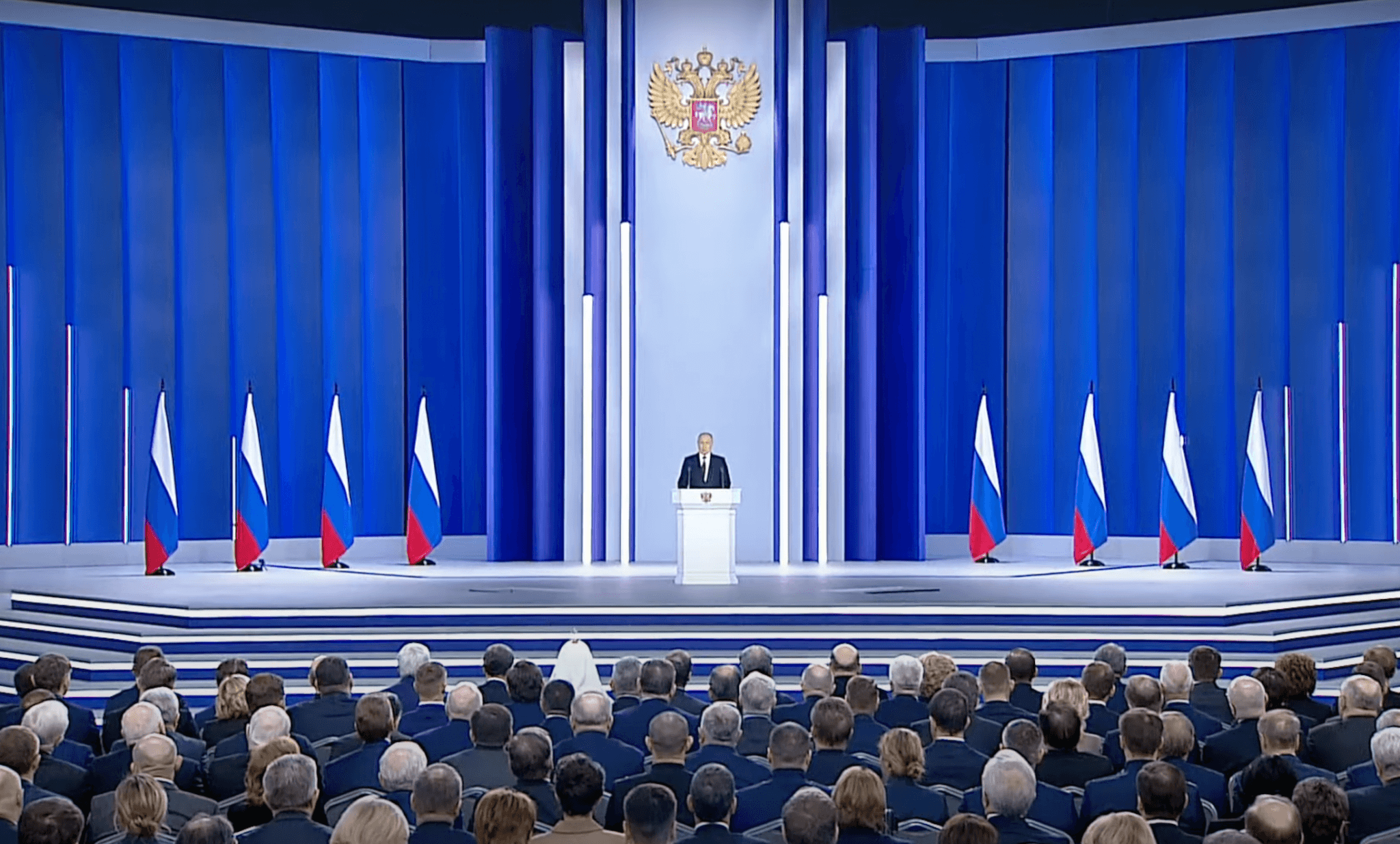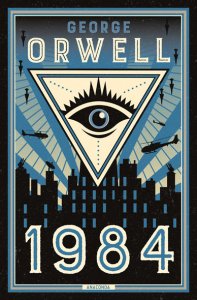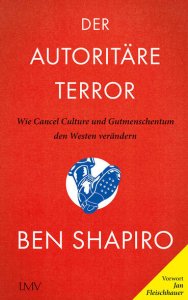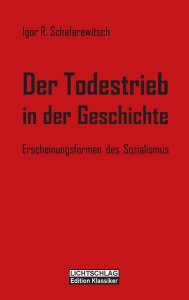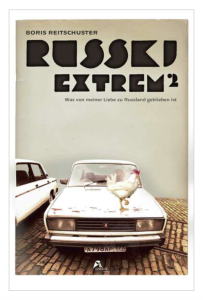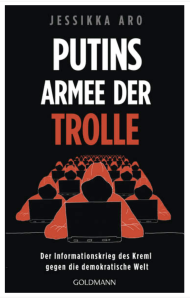Lesen Sie heute Teil 13 von „Putins Demokratur“. Warum ich Buch hier auf meiner Seite veröffentliche, können Sie hier in meiner Einleitung zum ersten Beitrag finden.
Der Mörder wartete im Treppenhaus. Am Samstag, den 7. Oktober 2006, dem Geburtstag von Wladimir Putin, lauerte ein Unbekannter der kritischen Journalistin um 16.30 Uhr in ihrem Hauseingang auf, als sie gerade Einkaufstüten in ihre Wohnung in die Lesnaja-Straße in Moskau bringen wollte. Der Täter schießt viermal auf die wehrlose, zierliche Frau. Als Politkowskaja schon getroffen am Boden liegt, feuert er noch eine Kugel in ihren Kopf – im Mafiajargon wird dieses grausame Ritual als »Kontrollschuss« bezeichnet.
Der Mord an Anna Politkowskaja, einer der prominentesten Kritikerinnen von Wladimir Putin, löst weltweit Empörung aus. Nur nicht im Kreml. Aus der ganzen Welt kommen von hochrangigen Politikern Worte des Beileids, Angela Merkel und George W. Bush äußern sich besorgt. Einer hüllt sich in Schweigen: Drei Tage lang findet Wladimir Putin öffentlich kein Wort des Beileids. Erst als er am Dienstag, den 10. Oktober, beim deutsch-russischen Gipfel in Dresden vor der Weltpresse steht, äußert er sich zu der Bluttat – nachdem ihn Angela Merkel darauf angesprochen hat. Seine Worte klingen nicht allzu mitfühlend. Eher pflichtschuldig verurteilt der Staatschef die Tat als »abscheuliches, inakzeptables Verbrechen« – was in den Medien breit zitiert wird. Nicht ganz so viel Beachtung findet dagegen eine andere Aussage Putins: Er macht der Toten indirekt Vorwürfe, ausgerechnet am Tag ihrer Beerdigung – in Russland ein Tabu. Putin stellt den russischen Staat als das eigentliche Opfer des Mordes dar: Politkowskaja habe keine Bedeutung in Russland gehabt, ihre Artikel hätten weniger Schaden angerichtet als der Mord an ihr, sagt der Präsident.
»Zynischer geht es nicht mehr«, klagt Oleg Panfilow vom Verband für Journalisten in Notsituationen: »Wenn kritische Berichte nach Ansicht Putins dem Land schaden, zeigt das seine Auffassung von Pressefreiheit.«
In Russland ist das Echo auf den Mord verhalten. Die Tat sei zwar »eine Bagatelle – aber eine angenehme«, schreibt ein Leser in der russischen Internet-Presserundschau www.inosmi.ru: nicht etwa eine Plattform radikaler Kräfte, sondern eines Tochterunternehmens der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti. In vielen Leserbeiträgen auf der Seite – allesamt von der Redaktion gegengelesen und zur Veröffentlichung freigegeben – ist klamm-heimliche Freude über den Tod der prominenten Kremlkritikerin zu lesen, nicht nur zwischen den Zeilen.
Der Hass kommt nicht von ungefähr. »Wir haben ein Klima der Intoleranz in Russland, in dem Kritik an den Mächtigen als Volksverrat gilt und Kritiker als Volksfeinde«, klagt der Meinungsforscher Leonid Sedow vom Moskauer Lewada-Zentrum. Politkowskaja, die mit ihren Artikeln über Korruption, Gewalt, Willkür und Verbrechen in Tschetschenien bekannt wurde, musste sich immer wieder vorwerfen lassen, sie verachte Russland. Der Wind der Intoleranz weht nicht nur von der Straße. Präsident Wladimir Putin drohte schon einmal öffentlich einem ausländischen Journalisten mit Kastration.
Gerüchte, wonach der Kreml hinter dem Mord stehe, weist selbst eine Oppositionspolitikerin wie Irina Chakamada zurück: »Aber das Problem bleibt, dass wir eine Atmosphäre haben, in der sich Kriminelle, die so eine Tat begehen, sicher fühlen, ja sogar glauben, ihr Handeln sei von oben insgeheim toleriert. Genau darin liegt die Verantwortung der Regierung.« Sogar aus dem Kremllager sind kritische Stimmen zu hören. »Weil auch gemäßigte Kritiker in unseren Medien nicht mehr zu Wort kommen, rücken Radikale wie Politkowskaja in den Vordergrund«, glaubt Sergej Markow, ein Moskauer Politologe mit gutem Draht zu Putin. »Diese Radikalisierung führt zu einem angespannten Klima.« Der Kreml müsse endlich daran arbeiten, dass in den Medien wieder Meinungsvielfalt herrsche.
Markow glaubt, dass Kremlgegner Politkowskaja ermordeten, um dem Präsidenten zu schaden. Ein Verdacht, den auch Putin selbst andeutet: Es gebe Hinweise auf Drahtzieher im Ausland, sagt Putin mit Blick auf flüchtige kremlkritische Oligarchen. »Wenn der Präsident so etwas sagt, fassen das die Staatsanwälte als Befehl auf, genau dieses Ergebnis vorzulegen«, fürchtet Roman Schlejnow, Politkowskajas Kollege von der Nowaja gaseta, einem der letzten kritischen Blätter in Russland. Hoffnung auf Aufklärung besteht kaum. Seit Putins Amtsantritt kamen in Russland mindestens sechzehn Journalisten ums Leben, darunter Paul Klebnikow. Der Chefredakteur von Forbes in Russland wurde 2004 ermordet. Hier und da findet und bestraft die Justiz die Täter – die Hintermänner aber wurden bisher in keinem einzigen Fall gefunden.
Doch nicht nur bei den Ermittlungen nach Auftragsmorden tun sich die Staatsanwälte schwer. Ende August 2006 wandte sich die liberale Partei »Union Rechter Kräfte« an die Ermittler und bat sie einzuschreiten, weil Radikale eine Liste mit »Feinden Russlands« ins Internet stellten und dazu aufriefen, die Genannten »zu eliminieren«. Auf den Todeslisten stand auch Anna Politkowskaja. Auf den Bittbrief der »Union Rechter Kräfte« hat die Staatsanwaltschaft bis heute nicht geantwortet.
Im August 2007 verkündet Generalstaatsanwalt Jurij Tschaika, der Mord sei aufgeklärt. Wenige Tage später werden durch Indiskretionen die Namen der Festgenommenen bekannt, mehrere werden freigelassen. »Ich glaube, der FSB und das Innenministerium haben die Ermittlungen gezielt torpediert«, sagt Dmitri Muratow, Chefredakteur der Nowaja gaseta, bei der Politkowskaja arbeitete. Die Ermittler hätten offenbar in ein Wespennest gestochen mit der Enthüllung, dass aktive und ehemalige Mitarbeiter des FSB sowie des Innenministeriums wesentlich an der Tat beteiligt waren und dass Geheimdienstler und Polizisten offenbar eng mit dem organisierten Verbrechen zusammenarbeiten – und zwar nicht nur im Fall Politkowskaja. »Die Korruption in diesem Bereich hat unter Putin unglaubliche Ausmaße erreicht, man kann davon sprechen, dass sich Kriminelle die Dienste von Beamten regelrecht leasen. Die Ermittlungen belegen das. So trägt
Anna Politkowskaja selbst nach ihrem Tod dazu bei, die wahren Verhältnisse in Russland ans Licht zu bringen.« Wie nun weiter ermittelt werde, hänge von Putin ab, glaubt Muratow: »Unsere Staatsanwaltschaft ist nicht unabhängig, das letzte Wort hat der Präsident. Alles hängt jetzt davon ab, ob Wladimir Putin den Mut hat, die Geister, die er selbst rief, zu bekämpfen und den ganzen Apparat von Grund auf zu reformieren.«
Strahlender Mörder
Es sind schwere Vorwürfe, die der Mann mit schmerzverzerrtem Gesicht und haarlosem Schädel auf seinem Sterbebett in London erhebt: Wladimir Putin sei für seinen Tod verantwortlich, sagt Alexander Litwinenko, kurz bevor er am 24. November 2006 im britischen Exil an einer Vergiftung durch radioaktives Polonium stirbt: »Es mag Ihnen gelingen, einen Menschen zum Schweigen zu bringen, aber der Proteststurm aus der ganzen Welt wird Ihnen bis ans Lebensende in den Ohren klingen«, so Litwinenkos letzte Botschaft an den Kreml-Chef. Der frühere KGB-Offizier war einer der schärfsten Kritiker des russischen Präsidenten. Er recherchierte über den Mord an der Journalistin Anna Politkowskaja und glaubte, Spuren zur KGB-Nachfolgeorganisation FSB gefunden zu haben. In einem Buch wirft er dem FSB vor, 1999 in Moskau und anderen Städten die blutigen Terroranschläge auf Wohnhäuser mit mehr als 300 Toten inszeniert zu haben, um den zweiten Tschetschenien-Krieg zu provozieren und so die Wahl Putins im Jahr 2000 zu sichern. Außerdem war Litwinenko ein Vertrauter des russischen Oligarchen Boris Beresowski, der sich mit Putin überworfen hatte.
Das offizielle Russland reagiert empört auf die Mordvorwürfe: »Sollte Russland einen Mord verüben, läge es doch in der Logik der Sache, Beresowski selber zu beseitigen«, kontert zynisch Gennadij Gudkow, Duma-Abgeordneter und ehemaliger FSBler. Doch die Tat zieht immer weitere Kreise. In den Flugzeugen, mit denen die mutmaßlichen Täter von Moskau nach Russland und zurück flogen, werden radioaktive Spuren festgestellt – ebenso wie an zwölf Orten in London und selbst in Hamburg, wo einer der Verdächtigen auf dem Weg nach London einen Zwischenstopp einlegte. Der Fall des vergifteten russischen Ex-Spions hält Europa in Atem.
Urintest führt auf die Spur
British Airways versucht, 33 000 Passagiere zu kontaktieren, die mit den strahlenbelasteten Maschinen geflogen waren. Betroffen sind auch 38 Flüge von und nach Düsseldorf und Frankfurt. Tausende Fluggäste, die vielleicht erhöhter Strahlung ausgesetzt waren, melden sich bei der Fluggesellschaft. Bei dem selbsternannten italienischen Geheimdienstexperten Mario Scaramella, der sich am 1. November mit Litwinenko getroffen hatte, ergab ein Urintest, dass sich eine besorgniserregende Menge an Polonium-210 in seinem Körper befindet. Er wurde in ein Londoner Krankenhaus eingeliefert.
Immer mehr Indizien sprechen dafür, dass Mitglieder des russischen Geheimdienstapparats ihre Finger beim Tod des 43-jährigen Ex-KGB-Agenten im Spiel hatten. Nach Informationen der britischen Zeitung The Guardian sucht die Polizei nach »mindestens fünf Männern«, die zusammen mit einer Gruppe russischer Fußballfans am 1. November zum Champions-League-Spiel zwischen ZSKA Moskau und Arsenal London in Großbritannien eingetroffen waren. Nach Informationen der Zeitung könnten sie über den »Schlüssel für den Tod des früheren Spions« verfügen.
Der Moskauer Geheimdienstexperte Nikita Petrow hält die FSB-Connection für nicht unrealistisch: »Seit Putins Amtsantritt gibt es niemanden mehr, der die Geheimdienste kontrolliert, sie sind völlig entfesselt, begingen mehrere Morde.« Doch selbst Putin-Kritiker in Russland vermuten die Gegner des Präsidenten im eigenen Machtapparat hinter der Tat. Die Hardliner wollten den Staatschef vom Westen isolieren und zu einem harten Kurs treiben. Das Wort vom »Putsch« der Geheimdienstler macht die Runde. »In Wirklichkeit haben einfach auch die meisten Kremlkritiker Angst, Putin selbst mit dem Mord in Verbindung zu bringen. Wer so etwas laut ausspricht, lebt im heutigen Russland sehr gefährlich«, sagt ein Oppositionspolitiker, der anonym bleiben will. »Im Westen heißt es, der Mord schade Putin. Das ist Unsinn. Ja, er schadet ihm im Ausland. Aber entscheidend ist das Inland. Und da ist der Mord ein klares Zeichen an alle: Verräter sind nirgends auf der Welt sicher. Wer sich gegen das System stellt, den kann dieses System überall niederstrecken.«
Die russischen Medien dagegen wittern in dem Mord an Litwinenko eine Verschwörung gegen Russland. Großbritannien werde die Affäre ausnutzen, um Moskaus Ansehen zu beschädigen, schreibt das Gazprom-Blatt Iswestia im Dezember 2006. Nachdem die britische Staatsanwaltschaft Mordanklage gegen den früheren russischen Geheimdienstmann Andrej Lugowoi erhebt, der inzwischen Abgeordneter im russischen Parlament ist, wittert die kremltreue Moskauer Zeitung denn auch prompt eine »offen antirussische Kampagne«. Die kremltreuen Fernsehsender und Zeitungen überschlagen sich mit Spekulationen. Keine Fährte scheint absurd genug, wenn sie nur vom russischen Staat wegführt.
‘Verschwörung des Westens‘
So wie Drogenkuriere manchmal unglaubliche Mengen Kokain oder Heroin in heruntergeschluckten Kondomen transportieren, wäre es auch möglich, Polonium in speziellen Kapseln einigermaßen ungefährlich zu schmuggeln. Diese sehr ausgefallene Erklärung für den Strahlentod von Alexander Litwinenko bringt die kremlnahe Internetseite russland.ru ins Gespräch. Ob tschetschenische Atombombe, zufällige Vergiftung mit Meerestieren in der Sushi-Bar, atomare Blutrache aus dem Kaukasus oder nuklearer Selbstmord: Keine Version und keine Verschwörungstheorie ist den russischen Medien zu abwegig – außer den Spuren, die Scotland Yard ausfindig gemacht hat. Von den Erkenntnissen der britischen Kripo wird eher wenig berichtet – und wenn, dann mit dem Hinweis, es könne sich um eine Verschwörung des Westens handeln. Ein Duma-Abgeordneter versteigt sich sogar zu der Aussage, wenn Moskau jemanden umbringe, dann geschickter.
Das russische Außenministerium beschwerte sich in Großbritannien, dass man die letzte Botschaft Litwinenkos – in der er den Kreml für seinen Tod verantwortlich macht – nicht zensiert habe. Nur eine Erklärung sei offenbar niemandem in den Sinn gekommen, bemerkt Alexander Osowtsew auf der Internetseite »alltägliches Journal« (EJ) spitz: Niemand kam auf die Idee zu sagen, dass in der russischen Führungsriege keiner zu so einer Tat fähig sei. Als Olof Palme umgebracht wurde, hätte nicht der leiseste Verdacht bestanden, einer seiner politischen Rivalen habe ihn ausgeräumt. Auch nach dem Mord an John F. Kennedy habe niemand seinem Nachfolger Johnson oder den Republikanern die Tat zugetraut. Mit Russland sei das heute genau umgekehrt: Es gebe kaum jemanden, der der heutigen Führung in Moskau die Todesfälle der letzten Wochen nicht zutrauen würde – und das spreche Bände, klagt Osowtsew.
Die Litwinenko-Affäre sorgt für heftige Verstimmungen zwischen Moskau und London. Die britischen Ermittler sind überzeugt, dass der frühere Agent Lugowoi seinen Ex-Kollegen Litwinenko mit dem radioaktiven Polonium vergiftete. Anhand der radioaktiven Spuren, die das Polonium hinterlassen hat, können die britischen Ermittler Lugowois Bewegungen minutiös rekonstruieren. Und die lassen offenbar keine weiteren Zweifel zu, dass der Mann, der beim KGB-Nachfolger FSB einst für den Schutz hochrangiger Personen zuständig war und zu einem engen Freund Beresowskis wurde, der Mörder ist. Beresowski äußert später den Verdacht, der Mordverdächtige Lugowoi sei gezielt vom Geheimdienst bei ihm eingeschleust worden mit dem Auftrag, sich sein Vertrauen zu erschleichen.
Schießübung auf das spätere Mordopfer
Die Theorie, dass ein Todeskommando aus Moskauer Geheimdienstlern hinter dem Mord steckt, erhält nicht nur durch einen Duma-Beschluss Auftrieb, der den Geheimdienst wenige Monate vor der Tat ermächtigte, Gegner Russlands auch im Ausland zu töten. Auch ein früherer FSB-Abteilungsleiter berichtete, Litwinenko sei vom FSB als Verräter zum Tode verurteilt worden. Später wurden Bilder publik, auf denen russische Sicherheitskräfte bei ihren Schießübungen auf ein Porträt des späteren Mordopfers schossen. Der Kreml weist jede Verwicklung in die Tat zurück.
Im russischen Staatssender 1. Kanal gibt Lugowoi ein ausführliches Interview: Der Ex-Geheimdienstler weist jede Schuld von sich – und kündigt »sensationelle Enthüllungen« an, ohne freilich Näheres zu verraten. Später erklärt er auf einer Pressekonferenz, der britische Geheimdienst selbst habe Litwinenko vergiftet, um Moskau die Schuld in die Schuhe zu schieben. Er liest seine Anschuldigungen von einem Blatt Papier vor, Details nennt er nicht, und auf Nachfragen antwortet er nur schwammig.
Kremlkritiker halten dagegen, mögliche Auftraggeber in Moskau hätten davon ausgehen können, dass der Mord nicht aufgeklärt wird: Drei Wochen lang konnten die Ärzte nicht feststellen, an welcher rätselhaften Vergiftung der gerade erst in Großbritannien eingebürgerte Russe litt. Nach dem Treffen mit Lugowoi in einer Sushi-Bar war ihm plötzlich übel geworden; im Krankenhaus stellten die Ärzte zwar Symptome der Strahlenkrankheit fest – konnten aber keine Radioaktivität nachweisen. Erst wenige Stunden vor Litwinenkos Tod kommen die Ärzte auf die ungewöhnliche Idee, die Ausscheidungen des Kranken auf radioaktive Spuren zu untersuchen: Sie finden Polonium. Dessen Alphastrahlung ist zwar im Inneren des Körpers tödlich, aber die Haut schirmt sie ab, sie kann von außen nicht gemessen werden. »Polonium ist das ideale Gift, und die Auftraggeber konnten davon ausgehen, dass es nie entdeckt wird und der Tod deshalb als ungelöster Fall abgeheftet wird«, glaubt der Exil-Oligarch Boris Beresowski. »Nur die Pionierleistung der britischen Ärzte machte den Auftraggebern einen Strich durch die Rechnung.« Beresowski, einst Förderer und inzwischen Intimfeind des russischen Präsidenten, glaubt fest an die Schuld Putins: »Einen hochradioaktiven Stoff wie Polonium können nur staatliche Stellen besorgen und befördern. Und alle staatlichen Stellen in Russland werden von Putin kontrolliert, er hat das selbst mehrfach erklärt und die Vertikale der Macht ausgerufen.« Beresowski glaubt, Lugowoi hätte zuerst Litwinenko umbringen und dann später in Moskau behaupten sollen, Beresowski selbst habe ihm den Auftrag für den Mord erteilt: »Das war eine typische KGB-Operation. Dass die Briten das Polonium entdeckten und dessen Spur nach Moskau verfolgen konnten, machte einen Strich durch die perfide Rechnung.«
‘Nebelkerzen nach KGB-Art‘
Für eine solche Aussage gibt es keine Belege. Merkwürdig erscheint Beobachtern jedoch, dass Moskau kein großes Interesse an einer Aufklärung des Mordes zu haben schien. Die Behörden hüllten sich in Schweigen. Englische Ermittler beklagten, ihre russischen Kollegen würden ihre Nachforschungen eher behindern als unterstützen. »Wenn Moskau ein gutes Gewissen hätte, würde es eifrig ermitteln«, glaubt der Moskauer Geheimdienstexperte Nikita Petrow. Seiner Ansicht nach konnte nur ein Geheimdienst »eine so schwierige Operation mit radioaktivem Material organisieren«. Allein der Wert des eingesetzten Poloniums soll zehn Millionen Dollar betragen. Die Berichte in den russischen Medien zu dem Fall, wie etwa in der Iswestia, glichen ebenfalls einer Geheimdienst-Operation, klagt Kremlkritiker Petrow: »Einziges Ziel der Berichte in den gesteuerten Medien ist es, nach KGB-Art Nebelkerzen zu werfen, die Menschen zu verwirren, so vom Offensichtlichen abzulenken und stattdessen die absurdesten Verschwörungstheorien zu verbreiten.«
Im Juli 2007 führt die Litwinenko-Affäre zu einer diplomatischen Krise zwischen Großbritannien und Russland. London weist mehrere russische Diplomaten aus und erklärt, es werde russischen Offiziellen keine Visa mehr ausstellen. »Dieser Schritt hat die Elite in Moskau getroffen und verunsichert wie kaum ein anderer zuvor«, glaubt die Politologin Lilia Schewzowa. »Die ganze anti-westliche Propaganda und die Wortgefechte kosten unsere Mächtigen nichts. Aber wenn sie ihre Wochenenden plötzlich nicht mehr in London verbringen können und ihre teilweise dort lebenden Frauen und Kinder dort besuchen – das geht für sie ans Eingemachte, da macht sich Unruhe breit.« Die Engländer hätten damit Maßstäbe gesetzt, so die Politologin: »Bisher war es umgekehrt: Da hat man mit Sanktionen dieser Art in erster Linie die einfachen Menschen getroffen und die Mächtigen geschont. Endlich hat das mal jemand umgedreht!« Die Affäre um den Litwinenko-Mord zeige, welch unterschiedliche Welten der Westen und Russland seien, so Schewzowa: »Ein Sprecher unseres Außenministeriums hat gesagt, er verstehe nicht, warum wegen des Todes eines einzelnen Menschen so viel Aufhebens gemacht wird. Die Verwunderung ist wohl aufrichtig: Unsere Machtelite versteht wirklich nicht, dass im Westen jedes einzelne Menschenleben zählt – und es sich eine westliche Regierung nach so einem Mord gar nicht leisten könnte, einfach zur Tagesordnung überzugehen.«
Im Januar 2016 kommt ein britischer Untersuchungsbericht zu dem Schluss, Präsident Putin habe »wahrscheinlich« die Ermordung Litwinenkos gebilligt. Der russische Geheimdienst FSB habe den Mord in Auftrag gegeben, so der Richter Robert Owen bei der Vorstellung des Untersuchungsberichtes vor Londons Oberem Gericht.64 Dass es überhaupt zu der Untersuchung kam, hatte die Witwe des Ermordeten, Marina Litwinenko, auf dem Rechtsweg gegen den britischen Staat durchsetzen müssen. Der war offenbar nicht interessiert an einer restlosen Aufklärung, um die Beziehungen zu Moskau nicht zu riskieren, so Marina Litwinenko.
Die Fortsetzung finden Sie in Kürze hier auf meiner Seite: Korruption und Willkür, Bestechende Bürokratie.
Den zwölften Teil Schweinwelt auf der Mattscheibe finden Sie hier.
Den zehnten Teil Zynismus statt Marxismus und den elften Teil Gerdshow auf Russisch finden Sie hier.
Den neunten Teil – Farce statt Wahlen – finden Sie hier.
Den achten Teil – Spiel ohne Regeln – finden Sie hier.
Den vorherigen, siebten Teil – Militarisierung der Macht – finden Sie hier (Teil 2).
Den sechsten Teil – Militarisierung der Macht – finden Sie hier (Teil 1).
Den fünften Teil – Putins bombiger Auftakt – finden Sie hier.
Den vierten Teil – Die Herrschaft der Exkremente – finden Sie hier.
Den dritten Teil – Mit Stalin in die Zukunft – die verratene Revolution – finden Sie hier.
Den zweiten Teil – „Der Gas-Schock – Moskaus Warnschuss“ – finden Sie hier.
Den ersten Text der Buchveröffentlichung finden Sie hier.
Meine Seite braucht Ihre Unterstützung!
Wenn Sie weiter Artikel wie diesen lesen wollen, helfen Sie bitte mit! Sichern Sie kritischen, unabhängigen Journalismus, der keine GEZ-Gebühren oder Steuergelder bekommt, und keinen Milliardär als Sponsor hat. Und deswegen nur Ihnen gegenüber verpflichtet ist – den Lesern!
1000 Dank!
Aktuell sind (wieder) Zuwendungen via Kreditkarte, Apple Pay etc. möglich – trotz der Paypal-Sperre:
Über diesen LinkAlternativ via Banküberweisung, IBAN: DE30 6805 1207 0000 3701 71 oder BE43 9672 1582 8501
BITCOIN Empfängerschlüssel auf Anfrage
Diejenigen, die selbst wenig haben, bitte ich ausdrücklich darum, das Wenige zu behalten. Umso mehr freut mich Unterstützung von allen, denen sie nicht weh tut.
Mein aktuelles Video
Stinke-Socken vom Vorgänger und Fenster-Öffnungs-Verbot – „Dschungelcamp“-Gefühle im Berlin-Urlaub.
Mein aktueller Livestream
Wie Habeck über Stalins Schnurrbart stolperte – und Esken sich dringt verriet.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr zu diesem Thema auf reitschuster.de