Von Matthias Heitmann
Ich bin ehrlich. Ich erfuhr von der Existenz von Harry Flynt erst an seinem gestrigen Todestag. Ich hörte, dass er der Gründer des „Hustler“ war und sein Leben dem Kampf gegen Prüderie und Zensur und für Pornografie und Meinungsfreiheit verschrieben hatte. Der „Hustler“ war mir ein Begriff, aber selbst wenn Millionen von Männern dasselbe behaupten: Ich hatte tatsächlich noch nie eine Ausgabe in der Hand.
Während „Playboy“ und „Penthouse“ in Hochglanz versuchten, Sex und nackte Haut als Gesprächsthema in die feineren Kreise der Gesellschaft hineinzutragen, versuchte Flynt gar nicht erst, sich über die moralische Gürtellinie hinaus zu etablieren. Der „Hustler“ stand seit jeher für ungeschminkte Pornografie, für Titten, Fotzen und Schwänze in eindeutigen Posen, für manche zu drastisch, zu obszön und widerwärtig, ein Hassobjekt des Feminismus, schmuddelig und dreckig, verunglimpfend, pervers, gotteslästerlich – gibt es noch andere böse Worte, die ich vergessen habe?
Ja, die gibt es, doch für die war Flynt nicht zu haben: Stets stritt er gegen Rassismus und gegen Homophobie, und er legte sich, wo er nur konnte, mit zensurwilligen Obrigkeiten an. Wie viel Zeit er vor Gerichten verbrachte, ist unklar. Noch mehr Zeit indes verbrachte Flynt aber im Rollstuhl, seit 1978 ein Fanatiker, dem die erotische Darstellung von schwarzer auf weißer Haut übel aufstieß, auf ihn schoss.
Flynts „perverser“ Lust an Provokation und Konfrontation tat dies keinen Abbruch. Und auch nicht seinem Engagement für die Freiheit und gegen die tatsächlichen Perversitäten der Wirklichkeit. So versuchte er, den Mann, der ihn in den Rollstuhl geschossen hatte, vor der Todesstrafe zu bewahren – was zu einer der für ihn wohl schmerzhaftesten Niederlagen wurde, die er vor Gerichten erlebte.
Einem Christen, der ihm sagte, dass Sex schmutzig sei, soll er einmal gesagt haben. „Ja genau, wenn man es richtig macht!“. Wahrscheinlich gäbe es noch viel mehr derartige Anekdoten über den Mann zu erzählen. Doch dies ist kein Nachruf. Ich hatte bis gestern von Flynt nie gehört, daher wäre es anmaßend, so etwas auch nur zu versuchen. Mein Interesse galt eher der Berichterstattung über den Tod Flynts und den Nachrufen in den deutschen Medien.
 Und ich war überrascht darüber, wie stark Flynts Eintreten für die Meinungsfreiheit betont wurde. Natürlich verbietet es sich, im Rahmen eines Nachrufs schlecht über einen Verstorbenen zu reden. Das mag ein Grund dafür gewesen sein. Zwar traute sich der Spiegel, Flynt einen „Drecksack“ zu nennen, aber immerhin einen „anständigen Drecksack“, „Ausbeuter einerseits, ein Ritter der Meinungsfreiheit andererseits“.
Und ich war überrascht darüber, wie stark Flynts Eintreten für die Meinungsfreiheit betont wurde. Natürlich verbietet es sich, im Rahmen eines Nachrufs schlecht über einen Verstorbenen zu reden. Das mag ein Grund dafür gewesen sein. Zwar traute sich der Spiegel, Flynt einen „Drecksack“ zu nennen, aber immerhin einen „anständigen Drecksack“, „Ausbeuter einerseits, ein Ritter der Meinungsfreiheit andererseits“.
So gut gemeint das ungeschriebene Gesetz, nicht schlecht über Tote zu reden, auch sein mag – im Falle Flynts wirkt das Ganze dann doch arg verlogen. Die Nachrufe stauben geradezu von frisch gefressener Kreide. Die Heuchelei wird dann besonders deutlich, wenn man sich vor Augen führt, dass dieselben Medien heute moralisch Amok laufen, wenn irgendwo Gendersternchen fehlen, T-Shirt-Träger rutschen, pseudo-pornografische Fotos gezeigt werden oder Menschen Worte benutzen, die mit F beginnen. Es ist atemberaubend, wie erfolgreich die Schere im Kopf wirkt.
Zeit seines Lebens soll sich Flynt politisch liberalen Kräften nahe gefühlt haben. Mit Donald Trump verband ihn inniger Hass. Gleichwohl stellt sich die Frage, wie das amerikanische liberale Establishment einen „perversen Schmutzhändler“, wie sich Flynt selbst bezeichnete, tatsächlich ertragen konnte. Und es stellt sich die Frage, ob Flynt dessen bodenlose Prüderie und zutiefst zensorische politische Korrektheit wirklich ertragen konnte.
Was mir nach der Lektüre einiger Nachrufe in deutschen Medien noch übler aufstieß als der Kreidestaub, war die Art und Weise, in der gewissermaßen zeitgleich mit Flynt auch die Meinungsfreiheit aus dem Leben verabschiedet wurde. Das zutiefst prüde Kokettieren mit Flynts Perversionen bei gleichzeitiger Beschneidung der Meinungsfreiheit erzeugte bei mir jedenfalls einen größeren Würgereiz als alles, was dieser Mann jemals gesagt und publiziert haben kann. Auch wenn es in unserer modernen Medienlandschaft nur ungern zur Kenntnis genommen wird: Meinungsfreiheit – und daraus resultierend auch die Pressefreiheit – gilt eben nicht nur für staatstragende hochintellektuelle Publikationen, sondern auch für Schmuddel- und Revolverblättchen.
Denn das ist das eigentlich Zentrale und auch Schöne an der Meinungsfreiheit: Sie interessiert sich einen Scheißdreck für Inhalte, egal, wie obszön und pervers man diese zu bestimmten Zeiten auch finden mag. Ich muss Larry Flynt weder analysieren noch persönliches Interesse an ihm oder seiner ach so schwierigen Kindheit heucheln, noch jemals einen „Hustler“ in Händen gehalten haben, um es gut zu finden, dass er immer das Recht auf Meinungsfreiheit verteidigt hat. Ich muss ihn als Person nicht mögen. Das genau ist die Bedeutung von Toleranz.
Ich kann nicht etwas tolerieren, das ich mag. Ich kann nur tolerieren, was ich ablehne. Insofern ist meine Ablehnung von etwas die Voraussetzung dafür, dass ich es tolerieren kann. Toleranz kann daher durchaus weh tun, aber sie führt eben auch dazu, dass ich lerne, mit der Wirklichkeit umzugehen, so wie sie ist. Wer im Umgang mit Meinungen und Ideen Grenzen der Toleranz einfordert, begrenzt damit nur sich selbst in seiner Wahrnehmung der Realität. Ich kann das Recht verteidigen, Meinungen und Standpunkte zu äußern, und dennoch diese Äußerungen inhaltlich bekämpfen – eigentlich kann ich nur dann Äußerungen inhaltlich bekämpfen, wenn ich sie nicht zensiere. Und so verhindere ich, dass Toleranz zur Gleichgültigkeit verkommt.
Meinungsfreiheit existiert erst dann, wenn sie für Äußerungen und Darstellungen gilt, die ich ablehne. Deswegen muss ich auch nicht Partei ergreifen für diejenigen, deren Recht auf Meinungsfreiheit ich verteidige. „Je suis Larry“? Keineswegs! Das hätte Flynt auch gar nicht gewollt. Er hatte die Bedeutung von Meinungsfreiheit tatsächlich verstanden und die höchsten US-Gerichte immer wieder dazu gebracht, ihm hier Recht zu geben. Danke dafür, Herr Flynt. Und wenn es einen Ort gibt, an dem Sie jetzt sind, dann wünsche ich Ihnen: Bleiben Sie dreckig und versaut!
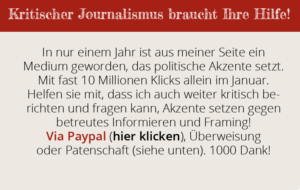
Gastbeiträge geben immer die Meinung des Autors wieder, nicht meine. Ich schätze meine Leser als erwachsene Menschen und will ihnen unterschiedliche Blickwinkel bieten, damit sie sich selbst eine Meinung bilden können.

Matthias Heitmann (Jahrgang 1971) ist freier Journalist, Buchautor und Kabarettist. Von ihm sind u.a. erschienen: „Zeitgeisterjagd. Auf Safari durch das Dickicht des modernen politischen Denkens“ (2015), „Zeitgeisterjagd spezial: Essays gegen enges Denken“ (2017) und „Schöne Aussichten. Die Welt anders sehen“ (2019). Zudem geistert er als „Zeitgeisterjäger FreiHeitmann“ mit eigenen Soloprogrammen über Kleinkunst- und Kabarettbühnen. Seine Website findet sich unter www.zeitgeisterjagd.de. Sein Podcast „FreiHeitmanns Befreiungsschlag“ erscheint regelmäßig auf www.reitschuster.de.
Bild: Ringo Chiu/Shutterstock
Text: Gast
mehr von Matthias Heitmann auf reitschuster.de




[themoneytizer id=“57085-1″]




