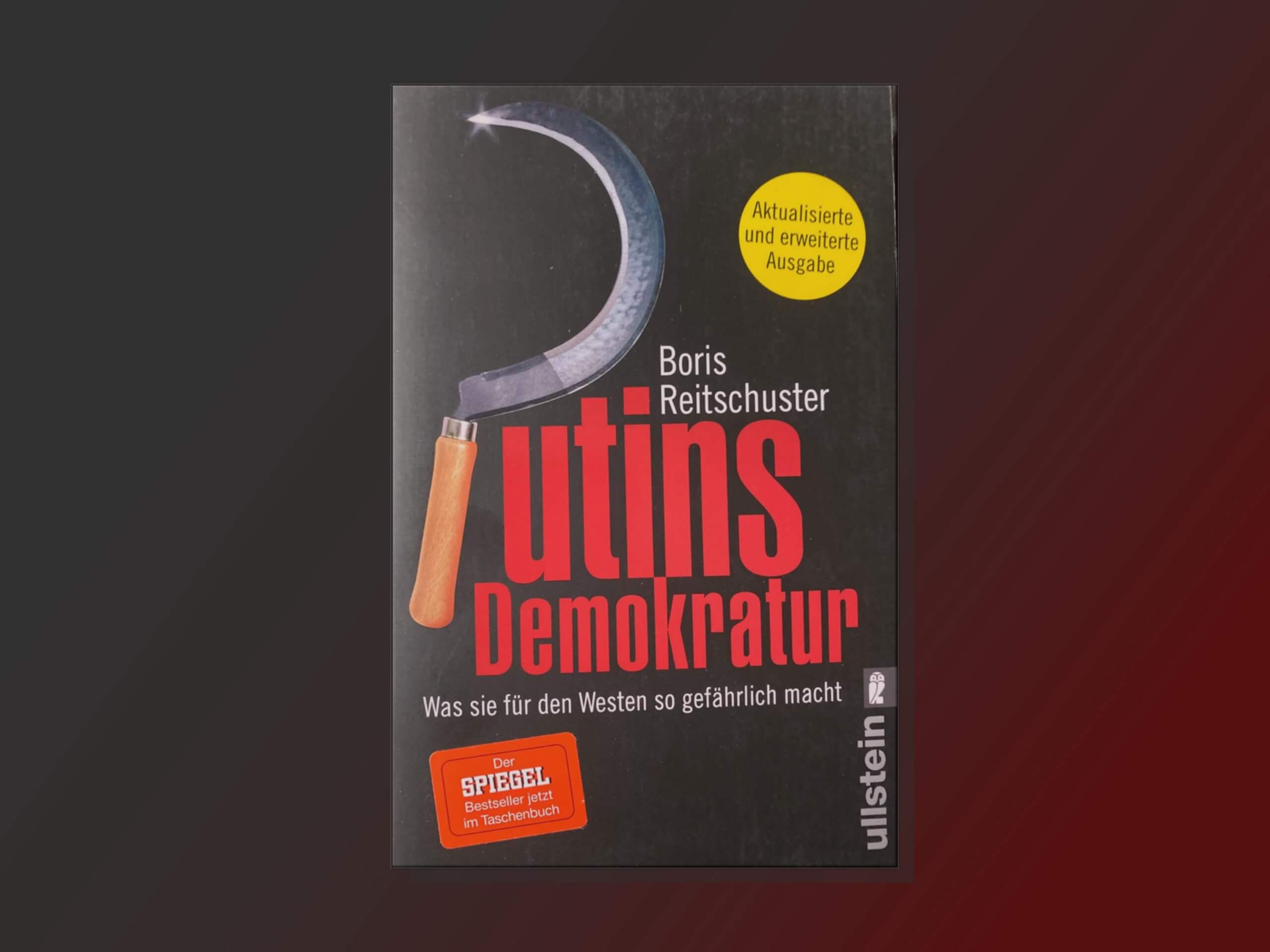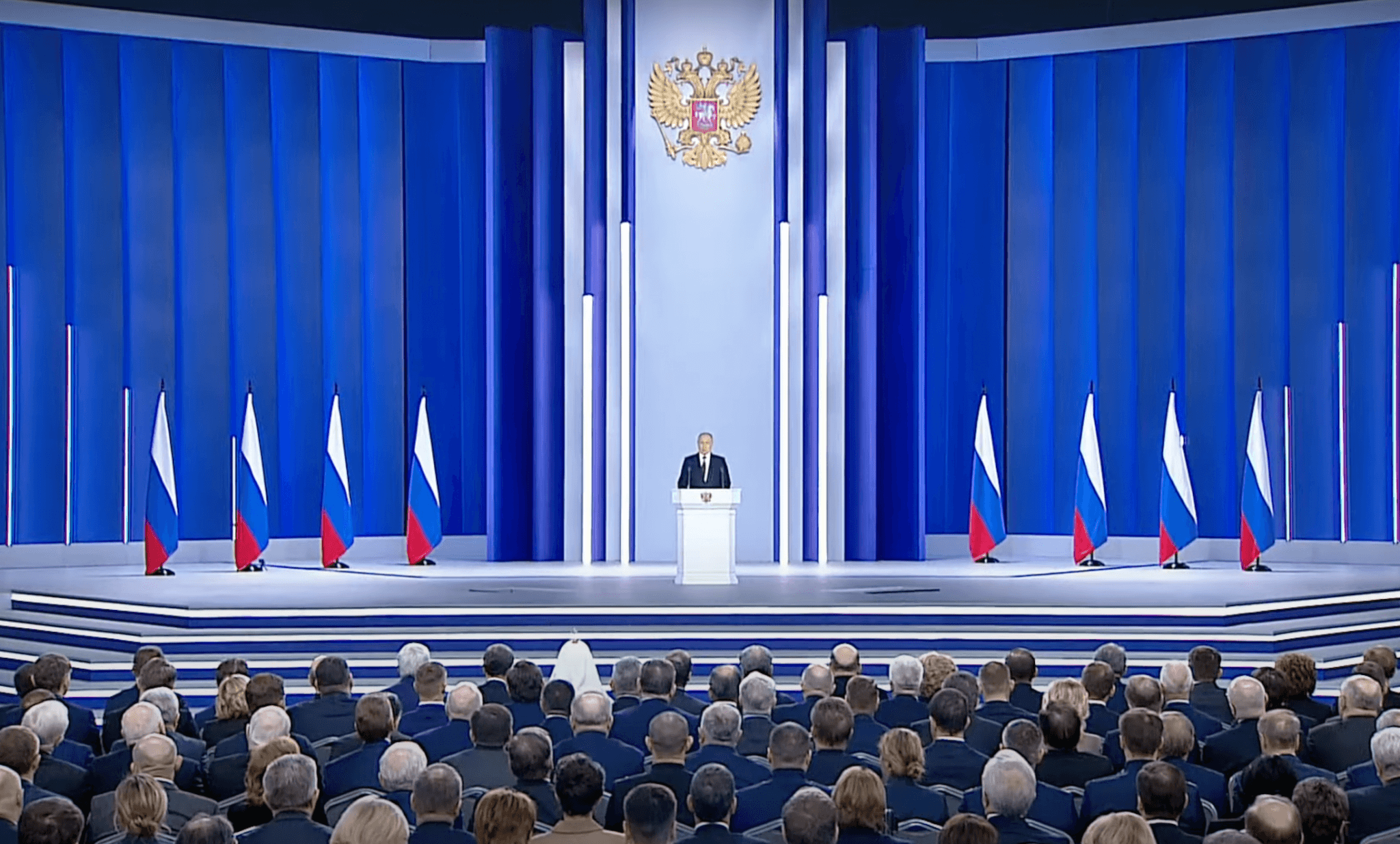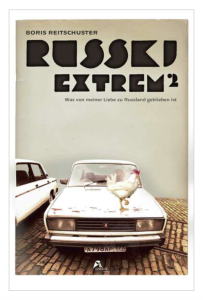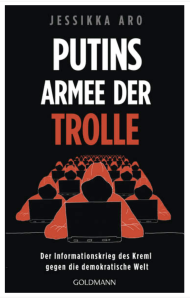Lesen Sie heute Teil 16 von „Putins Demokratur“. Warum ich Buch hier auf meiner Seite veröffentliche, können Sie hier in meiner Einleitung zum ersten Beitrag finden.
Harsch schlägt der Beamte im Kampfanzug dem alten Mann die Antenne seines Funkgeräts auf die Finger: »Hände weg!« Boris Chodorkowski hat den Gitterkäfig berührt, hinter dem sein Sohn Michail sitzt. Ein knappes Jahr nach seiner Festnahme führt Russlands Justiz den einst reichsten Mann des Landes im August 2004 im Moskauer Meschtschanski-Gericht vor wie einen Gewalttäter. Seine Eltern dürfen ihm nicht einmal die Hand geben.
»Aufstehen!«, »setzen!« – Richterin Irina Kolesnikowa, eine stets gelangweilt und gereizt dreinblickende Frau Anfang vierzig mit Sturmfrisur, kommandiert den früheren Chef des Ölgiganten Yukos und seinen Mitangeklagten und Kollegen Platon Lebedew wie junge Wehrpflichtige auf dem Kasernenhof. Wer von der kräftigen Frau mit der dicken Brille angesprochen wird, muss sich erheben. Auch wenn das nicht allen leichtfällt. Der Angeklagte Lebedew, der an Hepatitis leidet und ein eingefallenes, bleiches Gesicht hat, zieht sich jedes Mal schwerfällig mit der Hand an den Gitterstäben hoch. Lebedew ist 47 Jahre alt, sieht aber aus wie 60. »Er ist so krank, ihm droht der Tod, wenn er nicht endlich behandelt wird«, klagt seine Verteidigerin. Der Staatanwalt hält ihn für einen Simulanten.
Chodorkowski, der noch vor einem Jahr Russlands Vorzeigemanager war und dem nun Steuerhinterziehung und Wirtschaftsvergehen vorgeworfen werden, sitzt in einem schwarzen T-Shirt und einer alten, ausgewaschenen Jeans in seinem Käfig. Die Hose hat keinen Gürtel und ist offenbar etwas zu weit: Mehrmals zieht der Milliardär die Jeans hoch, wenn er aufstehen muss. Im Sitzen starrt er in sich gesunken minutenlang auf den Boden, ohne jede Bewegung. Sein Vater, von den Jahren gebeugt und mit rot unterlaufenen Augen, sucht von der Zuschauerbank aus immer wieder Blickkontakt mit seinem Sohn. Vergeblich.
»Es ist alles ein Albtraum«, flüstert Chodorkowskis Mutter. Die alte Frau mit den weißen Haaren und den großen, traurigen Augen sieht in ihrem weiß getupften blauen Kleid aus, als käme sie gerade vom Kirchgang. Sie kämpft den ganzen Tag mit den Tränen. »Wir dürfen Michail nur wenige Lebensmittel ins Gefängnis bringen; er kocht sich in der Zelle Brei«, erzählt sie.
In dem Käfig nimmt der Mitangeklagte Lebedew immer wieder einen Schluck aus einer grünen Plastikflasche, die neben ihm auf der Anklagebank steht. »Er müsste wegen der Krankheit Diät halten, aber er bekommt nur den üblichen Gefängnisfraß; das Einzige, was er gut verträgt, ist Milch, die er selbst zu Dickmilch reifen lässt«, erzählt Lebedews Tochter im Zuhörersaal. Zwei Stuhlreihen weiter kämpfen die Anwälte um die Freilassung ihres Vaters: »Wir protestieren dagegen, dass der vorliegende Arztbefund im Verfahren verwendet wird. Lebedew ist gesund, heißt es da. Doch das Papier trägt kein Datum, und die Ärzte haben ihn nicht einmal selbst untersucht.« Staatsanwalt Dmitri Schochin, ein junger, kleiner Mann in Uniform mit Goldknöpfen und ironischem Dauerlächeln, widerspricht: »Das Papier ist in Ordnung.« Die Richterinnen flüstern ein paar Sekunden miteinander: »Antrag abgelehnt.« Der Anwalt will widersprechen: »Aber da ist doch kein Datum.« Die Richterin blickt ihn durch ihre gewaltige Brille streng an: »Ich sagte, Antrag abgelehnt.«
»Es tut weh, das mit anzusehen«, sagt Chodorkowskis Mutter leise. Was auch immer die Verteidiger beantragen – nach kurzem Flüstern machen die drei Richterinnen das, was Staatsanwalt Schochin sagt. Einmal, erzählt ein Anwalt, beantragt Schochin, ein Papier zu den Akten zu nehmen, das Lebedew unterschrieben haben soll. »Aber da ist keine Unterschrift Lebedews, hier bitte, sehen Sie her, ich widerspreche!«, entgegnet der Anwalt. Darauf Schochin: »Ich beantrage, den Widerspruch der Verteidigung abzulehnen und das von Lebedew unterzeichnete Papier zu den Akten zu nehmen.« Der Anwalt wedelt mit dem Papier in der Luft, will zeigen, dass es gar keine Unterschrift darauf gibt: »Sehen Sie doch her!« Die Richterin unterbricht ihn: »Antrag der Staatsanwaltschaft angenommen, das von Lebedew unterzeichnete Papier wird zu den Akten genommen.«
»Es ist alles sinnlos«, sagt Lebedews Tochter, doch die Anwälte kämpfen weiter. Sie legen das Attest eines bekannten englischen Facharztes und Institutschefs vor. Nach den vorliegenden Unterlagen, so heißt es dort, bestehe der Verdacht, dass aus Lebedews Hepatitis längst Leberkrebs geworden sei; trotzdem hätten die Gefängnisärzte nicht einmal die notwendigen Tests durchgeführt. »Er bekommt seine Medikamente nicht und hat regelmäßig Schmerzen im rechten Unterbauch«, klagt ein Anwalt. »Wir beantragen, dass ihn ein unabhängiger Spezialist untersucht; in einer Fachklinik.« Staatsanwalt Schochin lächelt. Die Sitzung wird unterbrochen.
»Kein Kontakt!«, ermahnt einer der Polizisten Lebedews Tochter, als sie mit ihrem Vater sprechen will. Nach ein paar Minuten Pause geht es weiter. Staatsanwalt Schochin hält ein maschinegeschriebenes Blatt in Händen – es enthält eine umfassende Antwort auf den Antrag, den der Anwalt gerade erst gestellt hat. Entweder beherrscht Schochin ein »Schnelldruck-Verfahren«, oder er hat schon vorab Einblick in die Unterlagen der Anwälte – anders ist nicht zu erklären, wie er in Windeseile eine schriftliche Antwort fertig brachte. Schochin blickt auf das Blatt, redet langsam, beißt sich immer wieder auf die Lippen, macht quälende, sekundenlange Pausen zwischen den Wörtern: Lebedew sei gesund, die Gefängnisärzte hätten recht, und ein englischer Mediziner habe einem russischen Gericht überhaupt nichts zu sagen.
»Chodorkowski, wollen Sie was hinzufügen?«, fragt die Richterin. »Dann stehen Sie auf!« »Euer Ehren, Sie repräsentieren hier den Staat«, sagt der Milliardär zu seiner Richterin. Er hält seine rutschende Hose fest und gerät ein paar Mal ins Stocken: »Und der Staat kann hier zeigen, dass wir ein zivilisiertes Land sind, in dem Gefahr für Gesundheit und Leben der Bürger nur von Verbrechern ausgeht und der Staat Gesundheit und Leben schützt.« Richterin Kolesnikowa wirft ihm einen verächtlichen Blick zu: »Setzen!«
Das Gericht werde wohl nachgeben und Lebedew von einem Facharzt untersuchen lassen, meint draußen auf dem Flur eine der Anwältinnen, und sie sagt es ohne jede Freude: »Sie werden schon einen finden, der ihnen das passende Resultat ausstellt.« Die Frau irrt sich. »Antrag abgelehnt«, verkündet Richterin Kolesnikowa später mit teilnahmslosem Blick.
Die meisten Journalisten können all diese Eindrücke im Gerichtssaal nicht selbst erleben. Russlands wichtigster Prozess findet in einem kleinen, stickigen Saal statt. Gerade einmal 38 Zuhörer finden Platz, wenn sie eng zusammenrücken. 14 Plätze werden von Polizisten in Kampfanzügen besetzt, vier durch die amerikanischen Anwälte, dazu kommen ein Dutzend Verwandte der Angeklagten und ihre Yukos-Kollegen. Nur eine Handvoll Journalisten darf in den Saal und immer nur für ganz kurze Zeit. Nach jeder Unterbrechung werden die Journalisten ausgewechselt – wenn die Wächter sie nicht aus Versehen für Verwandte halten, wie den Autor. Formell ist das Verfahren damit zwar öffentlich; de facto kann aber niemand den Prozess auch nur halbwegs durchgängig verfolgen und sich damit ein zusammenhängendes Bild machen.
Die Verteidiger beantragen, die Verhandlung per Funk für die Journalisten in einen anderen Raum zu übertragen. »Euer Ehren, jede Technik würde die Prozessteilnehmer ablenken«, mahnt Staatsanwalt Schochin und blickt streng zur Richterin. »Wir haben für so eine Technik kein Geld, und fremdes Geld nehmen wir nicht«, sagt Kolesnikowa und ballt die Hände vor dem Mund, so dass ihre Worte kaum zu hören sind: »Antrag abgelehnt.«
Knapp ein Jahr später, im Mai 2005, wird das Urteil verkündet. Blaue Uniformen, wohin das Auge reicht. Absperrgitter entlang der Gehwege, alle drei Meter ein Milizionär. Nachdem am ersten Tag der Urteilsverkündung lautstark Kremlgegner vor dem Gerichtsgebäude demonstriert haben, ist ab dem zweiten Tag der ganze Straßenzug abgesperrt: Genau vor dem Gericht haben Bauarbeiten begonnen, überall steht schweres Gerät. Proteste für Chodorkowski vor dem Gericht sind von der Stadtverwaltung untersagt worden. Unbehelligt vor das Gericht ziehen dürfen dagegen kremltreue Demonstranten mit einheitlichen Spruchbändern. Ein riesiges Aufgebot an Milizionären prüft sorgfältig, wer passieren darf. Selbst Putin-Anhänger werden von den Milizionären zurückgewiesen: »Hier darf nur durch, wer auf den Listen steht!« »Welche Listen?«, fragt ein verhinderter Putin-Anhänger. »Die Listen bei den Vorgesetzten«, antwortet der Uniformierte.
In Sechsergruppen marschieren die Demonstranten zu Kleinbussen, die etwas abseits stehen; dort gibt es kostenlos belegte Brote und Getränke. »Es stehen genügend auf der Straße, die nächste Gruppe kann zur Brotzeit«, spricht ein Milizionär in sein Funkgerät.
Hundert Meter weiter steht ein halbes Dutzend Pro-Chodorkowski-Demonstranten. Ein Miliz-Oberst marschiert mit zehn Uniformierten heran. »Ihre Demonstration ist illegal«, brummt er. »Wir stehen einfach auf dem Gehweg, abseits der Absperrungen, was ist daran verboten?«, erwidert eine alte Frau. »Gehen Sie weg!«, raunzt der Oberst zurück. Er zieht einen der jungen Männer am Ärmel zu sich heran und schreit dann: »Das ist Widerstand gegen die Staatsgewalt, holt einen Bus mit Sondereinsatzkräften, nehmt die alle mit.«
Drinnen im Gerichtssaal sitzen die beiden Angeklagten in ihrem Stahlkäfig, lösen Kreuzworträtsel und schmökern in Zeitschriften. Ein halbes Dutzend Anwälte kämpft mit dem Schlaf. Einige Zuhörer spielen mit ihren Handys. Seit drei Tagen lesen die Richterinnen monoton die Urteilsbegründung vor: Mal schnell, mal langsam, mal stockend und leise, so dass im Saal kaum etwas zu verstehen ist. Das ermattende Schauspiel zieht sich insgesamt zehn Tage hin. Nach zwei oder drei Stunden vertagen die Richterinnen jedes Mal die Sitzungen. »Mit der Salamitaktik wollen sie das Ganze offenbar so lange hinziehen, bis das Interesse der Medien nachlässt«, klagt Chodorkowskis Anwalt Juri Schmidt.
Wladimir Putin weist Kritik am Yukos-Verfahren mehrfach zurück; die Justiz sei unabhängig. Am 31. Dezember 2004 erhält Yukos-Ankläger Schochin, längst vom Major zum Oberst der Staatsanwaltschaft befördert, aus den Händen des Präsidenten den russischen Ehrenorden »für Verdienste bei der Festigung von Gesetzlichkeit und Recht«. Mehrere weitere Staatsanwälte, die mit dem Yukos-Fall befasst sind, werden ebenfalls ausgezeichnet. Generalstaatsanwalt Ustinow erhält später per Geheimerlass vom Staatschef den »Orden für Mut« und die höchste Auszeichnung des Landes, den Orden als »Held Russlands«.
»Bundeskanzler Schröder unterstützt den Prozess gegen Yukos völlig, er ist überzeugt, dass man Menschen bestrafen muss, die jahrelang die Steuern nicht bezahlt haben, die die Duma bestochen haben, bei Korruptionsgeschäften mitgemacht haben.« Mit diesen Worten zitiert am 31. Mai 2005 »Radio Liberty« in Moskau den Berliner Russland-Experten Alexander Rahr. Von Schröder selbst ist zwar kein entsprechendes Zitat überliefert, aber das werden die russischen Hörer kaum nachprüfen können.
Der Staat habe ein Recht, seine Steuern einzutreiben, weist Russlands Außenminister Lawrow Kritik am Yukos-Verfahren zurück: Auch im Westen gebe es Steuerverfahren, etwa in den USA gegen Mitarbeiter von Enron sowie gegen Parmalat in Italien. »Und niemand hält das für einen Abfall von der Demokratie«, klagt der Außenamtschef.
Ranghohe Kremlbeamte sehen das anders. »Der Prozess gegen Chodorkowski ist organisiert worden als Schauprozess zur Belehrung der anderen russischen Unternehmen«, verkündet Igor Schuwalow, ein enger Berater von Präsident Putin, freimütig: »An der Stelle von Yukos hätte jeder andere Konzern stehen können.« Damit gibt Schuwalow nicht nur zu, dass es sich um Willkür handelt, er gebraucht auch ein Wort, das aus der Stalinzeit berüchtigt ist.
Im Juli 2005 veröffentlichen 50 bekannte Sänger, Schauspieler, Künstler, Sportler und Showgrößen in der Iswestia einen offenen Brief, in dem sie das Urteil gegen Chodorkowski unterstützen. Der Staat müsse dem Gesetz verpflichtet sein, das für alle gleich sei, heißt es in dem Schreiben. Die Medienkampagne zur Unterstützung von Chodorkowski untergrabe den »Respekt vor dem Gesetz und die Normen von Sittlichkeit und Moral«, so die 50 prominenten Unterzeichner. Der Fernsehjournalist Alexander Gordon und der Schriftsteller Dmitri Lipskerow beschuldigen den liberalen Sender »Echo Moskaus« der tendenziösen Berichterstattung: Die »liberale Propaganda« in Russland werde »immer aufdringlicher« und gebärde sich »totalitärer als das sowjetische Modell«.
Die Redaktion der Iswestia distanziert sich am Tag darauf von dem offenen Brief.26 Wenige Monate später entlässt Gazprom als neuer Eigner der Iswestia den Chefredakteur, unter dem dieser kritische Beitrag erschien.
Auf die Bitte um ein Interview mit dem Ex-Yukos-Chef antwortet die Staatsanwaltschaft, dies sei dem Inhaftierten nicht zuzumuten, da man seine Interessen schützen und ihm genügend Zeit lassen müsse, die Gerichtsakten zu studieren.
Die Staatsanwaltschaft erklärt den Yukos-Konzern zur »kriminellen Vereinigung«. Sie bringt fast alle Yukos-Manager hinter Gitter, derer sie habhaft wird. Manchmal vergehen nur wenige Tage zwischen der Ernennung eines neuen Angestellten durch Yukos und dessen eiliger Festnahme durch den Staat. Auch Swetana Bachmina, stellvertretende Leiterin der Rechtsabteilung von Yukos Moskau und Mutter von zwei Kindern im Alter von vier und neun Jahren, kommt vor Gericht. Bei der ersten Vernehmung eröffnen die Ermittler der 36-Jährigen, sie seien verärgert, dass ihr Vorgesetzter nach London geflohen sei, wo ihm ein englisches Gericht Asyl gewährte – wie vielen anderen Yukos-Managern. Dafür müsse jetzt eben sie, Bachmina, den Kopf hinhalten. Die Staatanwaltschaft wirft ihr Diebstahl und Steuerhinterziehung vor. Die Vertreter des angeblich bestohlenen Unternehmens sagen vor Gericht jedoch aus, ihnen sei keinerlei Schaden entstanden. Selbst Zeugen der Staatsanwaltschaft bescheinigen der jungen Frau, sie habe weder eine Unterschriftsberechtigung noch eine Weisungsbefugnis gehabt. Die Richter verurteilen Bachmina im April 2006 trotzdem zu sieben Jahren Haft; bei einem Strafmaß von sechs Jahren wäre sie als zweifache Mutter kleiner Kinder automatisch unter eine Amnestie gefallen. Die Yukos-Angestellte erhält damit eine viel härtere Haftstrafe als beispielsweise der Unternehmer und mutmaßliche »Pate« Anatoli Bykow, der für die Organisation eines Mordversuchs zu acht Jahren auf Bewährung verurteilt wurde und den Gerichtssaal als freier Mann verließ.
Auch im Berufungsverfahren gegen Michail Chodorkowski setzt das Moskauer Stadtgericht neue Maßstäbe: Dauerte allein die Verlesung des Urteils in erster Instanz tagelang, wickeln nun drei Berufsrichter das Verfahren, dessen Unterlagen 6 500 Seiten Gerichtsprotokolle, 450 Aktenordner Ermittlungsunterlagen und ein 700 Seiten langes Urteil umfassen, in einem »Blitzprozess« innerhalb eines einzigen Tages ab. Vor der Verhandlung dürfen die Anwälte zwei Wochen lang nicht mit dem Angeklagten sprechen. Chodorkowski kann die Aktenberge eigenen Angaben zufolge angesichts der Zeitnot nur zu einem Bruchteil sichten. Entsprechende Einwände wischen die Richter einfach vom Tisch.
»Das war kein Verfahren, das war Formel 1«, klagt Anwalt Schmidt: »Das Gericht versuchte nicht einmal, den Schein des Anstands zu wahren. Das liegt sicher auch am Schweigen des Westens.« Die Hetze sei notwendig gewesen, um zu verhindern, dass Michail Chodorkowski bei der bevorstehenden Nachwahl in Moskau wie geplant für einen Parlamentssitz kandidiert, glaubt der Anwalt: »Erst durch den Richterspruch ist die Verurteilung rechtskräftig, und als Verurteilter darf Chodorkowski nicht kandidieren.« Das Gericht verringert Chodorkowskis Haftstrafe von neun auf acht Jahre.
Im Oktober 2005 verlegt die Gefängnisbehörde Chodorkowski in ein Straflager in Krasnokamensk an der chinesischen Grenze, ein radioaktiv belastetes Uranabbaugebiet. Seinen Aufenthaltsort hält sie tagelang geheim. Das Gesetz schreibt vor, die Angehörigen unverzüglich über Verlegungen zu informieren und Gefangene entweder in ihrer Heimatregion oder benachbarten Regionen ihre Strafe absitzen zu lassen – also im Falle Chodorkowskis in Moskau oder dem Umland. Die Gefängnisverwaltung behauptet zuerst, die Haftanstalt in der sechs Flugstunden von Moskau entfernten Stadt im Fernen Osten sei die nächste mit einem freien Platz gewesen. Als Chodorkowskis Anwälte eine Liste mit zahlreichen näher liegenden Gefängnissen mit freien Kapazitäten vorlegen, verweist die Gefängnisverwaltung darauf, dass Chodorkowski im Fernen Osten sicherer sei.
In dem Straflager wird Chodorkowski mehrfach zu Karzerstrafen verurteilt, unter anderem weil er »unerlaubt Tee trinkt« und »unerlaubte Schriftstücke« aufbewahrt – Erlasse des Justizministeriums. Innerhalb von Monaten bekommt der frühere Ölbaron nur zweimal die abonnierten Zeitungen – angeblich weil die Zensoren mit der Lektüre nicht nachkommen. Ein über ihn erschienenes Buch darf er nicht lesen. Ein Besuch seiner Frau wird unter Hinweis auf Reparaturarbeiten in den Besuchsräumen verboten.
Hinter Gittern bekommt Chodorkowski Zuspruch von Vater Sergej, dem Lagerpfarrer. Die beiden Männer verstehen sich auf Anhieb. Der Vorsteher der russisch-orthodoxen Spasski-Kirche, ein schüchterner Mann, der mit seinem grauen Bart auch ohne Verkleidung ein wenig wie Väterchen Frost aussieht, kennt Russlands Gefängnisse nicht nur als geistlicher Beistand: Mit 18 Jahren kam er wegen »antisowjetischer Handlungen« selbst vier Jahre hinter Gitter. Er fand Zuflucht bei Gott. Nach dem Ende der Sowjetunion wurde er Pfarrer. »Als ich damals selber saß, sagten die KGBler, sie träumten von dem Tag, an dem die politischen Gefangenen wie gemeine Verbrecher behandelt werden. Jetzt hat sich ihr Traum erfüllt«, empört sich Vater Sergej in einem Interview. Der 49-Jährige weigert sich, einen Verwaltungsbau im Lager zu segnen, weil dort mit Chodorkowski ein »politischer Häftling« sitze. Sein Bischof versetzt Vater Sergej in ein tausend Kilometer entferntes, abgelegenes Taiga-Dorf. Er dürfe nicht schweigen, glaubt er. Und nennt die Versetzung eine »Verbannung«. Das ist zu viel für die kremltreue Kirchenleitung, die kein Problem damit hat, Waffen für Tschetschenien zu segnen. Am 21. März 2006 entzieht sie dem Geistlichen wegen »Einmischung in die Politik« die Erlaubnis, Messen zu lesen. Vater Sergej ist jetzt arbeitslos. Bürgerrechtler sammeln Spenden für seine Familie. Sergej will keine. Er vertraut auf seine Herztropfen und seinen Glauben: »Gott wird helfen.«
Ein Beamter aus der Leitung des Straflagers habe ihm anvertraut, dass aus Moskau der Befehl gekommen sei, »den Bock fertigzumachen« – also Chodorkowski, berichtet Vater Sergej. Im April 2006 greift ein Mithäftling Chodorkowski im Schlaf mit einem Messer an. Die Behörden versuchen den Vorgang offenbar zu vertuschen; erst zwei Tage später erfahren die Anwälte von der Attacke. »Sein Gesicht ist übel zugerichtet«, berichtet sein früherer Partner Leonid Newslin aus dem Exil in Israel. Die Gefängnisverwaltung wiegelt ab, Chodorkowski habe lediglich bei einem Streit mit »einem jungen Freund« einen Fausthieb auf die Nase bekommen und einen Kratzer davongetragen. Warum er wegen einer solchen Lappalie mehrere Tage auf der Krankenstation bleiben muss, erklärt der Beamte nicht. Die Nachrichtenagentur Interfax meldet später unter Berufung auf nicht näher benannte Quellen, Chodorkowski habe den jungen Mitgefangenen sexuell belästigt. Homosexualität gilt in Russland oft als ehrenrühriger als manches Kapitalverbrechen.
Leonid Newslin, Mehrheitseigner der Menatep-Gruppe, die Yukos kontrolliert, ist überzeugt, dass Putin seine Behörden und den Geheimdienst beauftragt habe, Chodorkowski um jeden Preis zu brechen, ihn zu erniedrigen. Westlichen Menschenrechtsorganisationen wirft Newslin vor, sie hätten mit ihrer Weigerung, Chodorkowski als politischen Gefangenen anzuerkennen, der »Willkür und Gewalt« der Behörden gegen den Inhaftierten den Weg geebnet.
Die Yukos-Affäre sei der letzte Tabubruch gewesen, die Behörden kassierten sie seit der Yukos-Affäre noch ungenierter ab als zuvor, klagt ein Geschäftsmann in der Provinzstadt Kostroma stellvertretend für viele seiner Kollegen: »Da wurde ein Exempel statuiert; ob beabsichtigt oder nicht – das war das Signal an die Apparatschiks im ganzen Land, dass Unternehmer vogelfrei sind.«
»Für meine Freunde alles, für meine Gegner das Gesetz«, soll einst der spanische Diktator Franco gesagt haben. Francos Aussage trifft das Dilemma des Yukos-Verfahrens: Wo Gesetze willkürlich angewendet und verdreht werden, wird aus Recht Unrecht.
»Das ist die Vernichtung eines Unternehmens. Nun ist das Hauptziel der Angriffe auf Yukos klar«, schreibt die Nesawissimaja gaseta in Moskau: »Es geht darum, den reichsten Ölkonzern Russlands zu zerschlagen. Durch die heimische Wirtschaft weht der Geist der Anarchie, der jegliche Art von Eigentum als Diebstahl brandmarkt. Genauso ist es mit dem Yukos-Konzern. Das Hab und Gut, das er selbst gestohlen hat, wird jetzt beschlagnahmt und verkauft.«
Putins Wirtschaftsberater Andrej Illarionow nennt das Vorgehen der Behörden gegen den Ölriesen »den Schwindel des Jahres«. Prompt verliert der Liberale seine wichtigsten Aufgaben innerhalb des Kreml. Unter den Wirtschaftsführern aus der Jelzin-Zeit geht die Angst um. Viele flüchten ins Ausland, zumindest eine Zeit lang. Die Oligarchen von einst werden zunehmend zu Hausverwaltern in den Betrieben, die von ihnen gesteuert wurden.
Die Einsätze im Kreml-Monopoly sind gewaltig. Im Jahr 2004 erklärte Putin per Ukas mehr als 1 000 Firmen zu »strategischen Unternehmen«, die unter besonderer Obhut des Staates stehen und von ihm direkt oder indirekt kontrolliert werden. Dass Staatsvertreter Posten in den Aufsichtsräten staatlicher Unternehmen innehaben, ist auch in anderen Staaten üblich, wobei sie bei solchen Gremien eher selten Vorsitzende sind. Dass hohe politische Beamte aber riesige Konzerne mit Milliardenumsätzen de facto unter Kontrolle haben wie in Russland, ist in westlichen Marktwirtschaften kaum vorstellbar. Die Verflechtungen zwischen Beamten und Unternehmen haben ungeheure Ausmaße erreicht.
Schon Anfang der neunziger Jahre wurden rund 70 Prozent des russischen Bruttosozialprodukts von zwanzig bis dreißig großen Business-Clans kontrolliert – Tendenz steigend. Die Wirtschaftsriesen erdrücken die Konkurrenz, was ihnen auch deshalb besonders leicht fällt, weil sie in den vergangenen Jahren immer enger mit der Staatsmacht verflochten wurden. Wo echte, lebendige Konkurrenz fehlt, wo wichtige Entscheidungen unter undurchsichtigen Umständen in Amtsstuben getroffen werden, sind wirklicher Erfolg und Fortschritt nicht möglich.
Der hohe Ölpreis ist für Russland Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite füllt er die Staatskassen. Auf der anderen Seite verringert er den Druck für wirkliche Reformen, hilft, ein nicht konkurrenzfähiges, nicht effizientes System am Leben zu erhalten. Die Politik ist mehr mit dem Geldverteilen beschäftigt als damit, Strukturen zu wandeln und die Wirtschaft unabhängiger vom Ölexport zu machen. Die Ölverkäufe spülen enorme Devisensummen nach Russland.
In der Wirtschaftswissenschaft nennt man das Phänomen, das erstmals in den siebziger Jahren in den Niederlanden beobachtet wurde, »die holländische Krankheit«. Der Name bezeichnet eine beunruhigende Entwicklung: Hohe Exporteinnahmen, in diesem Fall durch Rohstoffe, führen durch eine Aufwertung der Währung zu Absatzproblemen in anderen Wirtschaftszweigen. Der »Rohstoff-Fluch« löst Krisen in den betroffenen Industrien bis hin zu deren Absterben aus. Von den Gegenmitteln – etwa Steuersenkungen oder Währungsausgleich – macht Russland keinen Gebrauch: Es genießt die »Rohstoff-Party« in vollen Zügen und nimmt damit die Gefahr eines bösen Erwachens in Kauf.
Die Fortsetzung finden Sie in Kürze hier auf meiner Seite: Putins Politbüro am See.
Den fünfzehnten Teil – „Call-Girls“ gegen Yukos – lesen Sie hier.
Den vierzehnten Teil – die Diktatur der Apparatschiks – lesen Sie hier.
Den dreizeiten Teil – Feinde und Verräter – lesen Sie hier.
Den zwölften Teil Schweinwelt auf der Mattscheibe finden Sie hier.
Den zehnten Teil Zynismus statt Marxismus und den elften Teil Gerdshow auf Russisch finden Sie hier.
Den neunten Teil – Farce statt Wahlen – finden Sie hier.
Den achten Teil – Spiel ohne Regeln – finden Sie hier.
Den vorherigen, siebten Teil – Militarisierung der Macht – finden Sie hier (Teil 2).
Den sechsten Teil – Militarisierung der Macht – finden Sie hier (Teil 1).
Den fünften Teil – Putins bombiger Auftakt – finden Sie hier.
Den vierten Teil – Die Herrschaft der Exkremente – finden Sie hier.
Den dritten Teil – Mit Stalin in die Zukunft – die verratene Revolution – finden Sie hier.
Den zweiten Teil – „Der Gas-Schock – Moskaus Warnschuss“ – finden Sie hier.
Den ersten Text der Buchveröffentlichung finden Sie hier.
Meine Seite braucht Ihre Unterstützung!
Wenn Sie weiter Artikel wie diesen lesen wollen, helfen Sie bitte mit! Sichern Sie kritischen, unabhängigen Journalismus, der keine GEZ-Gebühren oder Steuergelder bekommt, und keinen Milliardär als Sponsor hat. Und deswegen nur Ihnen gegenüber verpflichtet ist – den Lesern!
1000 Dank!
Aktuell sind (wieder) Zuwendungen via Kreditkarte, Apple Pay etc. möglich – trotz der Paypal-Sperre:
Über diesen LinkAlternativ via Banküberweisung, IBAN: DE30 6805 1207 0000 3701 71 oder BE43 9672 1582 8501
BITCOIN Empfängerschlüssel auf Anfrage
Diejenigen, die selbst wenig haben, bitte ich ausdrücklich darum, das Wenige zu behalten. Umso mehr freut mich Unterstützung von allen, denen sie nicht weh tut.
Mein aktuelles Video
Umerziehen statt informieren: Tilo Jungs Bauchklatscher – eine Selbstentlarvung der Medien-Branche
Mein aktueller Livestream
Das 20-jährige Opfer von Bad Oeynhausen ist tot – Opfer eines Gruppenangriffs „südländischer Männer“
Mannheimer Polizist verstorben nach Islamisten-Attentat – warum Politik und Medien mitschuldig sind
Bild: bloknot.ruMehr zu diesem Thema auf reitschuster.de